
Barabbas Dialoge
Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot
Besuchte Vorstellung: 3. Juli 11
Mit den „Barabbas Dialogen“ bot die Oper Frankfurt jetzt ein musikalisches Bonbon der Sonderklasse zum Ende der Programmreihe „Oper Finale“, die Aulis Sallinens „Kullervo“ thematisierte. Seine Kammerkantate „Barrabas Dialoge“ wurde in der Studiobühne des Bockenheimer Depot als deutsche Erstaufführung gezeigt und sie beendete auch die laufende Spielzeit der Oper Frankfurt. Sallinen komponierte das Stück für das finnische Naantali Musikfestival. Es ist nicht leicht, das Werk in eine übliche Kategorie einzuteilen. Es ist Musiktheater, Kammeroper, Oratorium, selbst Sallinen lässt offen, was es nun eigentlich ist. So kann jeder Zuschauer selbst entscheiden, als was er es wahrnimmt.
Es wird keine geschlossene Geschichte erzählt, es gibt auch keine wirklichen Dialoge (trotz des Titels). Die gesungenen Texte sind mehr Gedankenstifter, dargeboten in sieben Erzählungen, die um die Themen Schuld und Verdammnis kreisen (womit auch eine Brücke zu „Kullervo“ geschlagen ist). Hier steht aber kein traumatisierter Mensch im Mittelpunkt, sondern Barabbas. Jener Barabbas, der alternativ zu Jesus hätte gekreuzigt werden können.
Denn vor über 2000 Jahren war es im Staate Israel üblich, dass zum Passahfest ein Gefangener Amnestie erlangte. Wie das Neue Testament in den Evangelien berichtet, entschied sich damals das Volk, aufgestachelt von den Hohepriestern, aber anders als Statthalter Pilatus gedacht hatte. Statt Jesus kam Barabbas frei. Viel mehr ist über ihn gar nicht bekannt, selbst ob er nun Räuber, Mörder oder ein Freiheitskämpfer war, steht nicht fest. Der schon zum Tode verurteilte Barabbas jedenfalls wurde freigelassen und musste erleben, wie ein Unschuldiger gekreuzigt wird.
Sallinen schrieb das Libretto selbst, nahm dabei neben biblischen Texten auch Verse des Dichters Lassi Nummi auf. Er fügte weitere biblische Figuren ein, wie die des Verräters Judas, einen der Jünger Jesus’ und als Kontrastfiguren ein junges Paar, sowie die Frau des Barabbas (die in der Bibel gar nicht erwähnt wird).
Die Inszenierung von Ute M. Engelhardt stellt die Figuren stark in den Mittelpunkt. Zu Beginn sitzt „Die Frau“ (Sharon Carty) gefesselt und leidend auf einem Stuhl am Bühnenrand, Dunkelheit ist um sie herum, nur sie selbst befindet sich in einem Lichtspot (Licht: Alexander Kirpacz). Ein Mann kauert in einem großen Käfig, ein anderer im Hintergrund. Sie entpuppen sich als Barabbas und Judas.
Die Bühne von Julia Müer besteht aus mehreren Podesten und Hohlräumen, die über Stege verbunden sind (gespielt wurde in der kleineren Studiobühne des Bockenheimer Depots). Es sind kleine Fluchträume für die Protagonisten, die so plötzlich auftauchen, wie sie wieder verschwinden oder auch kauernd in Ecken verharren. Einer rennt stets hin und her: „Einer der Zwölf“, ein Erzähler, hier in Form eines Jungen (Luca Paredes-Montes), der dabei weisungsvolle Botschaften kundtut. Zelebriert werden Momente der Furcht, der Bedrückung, aber auch der Freude, der Erwartung und der Hoffnung, die im großen finalen Friedenanflehen endet.
Aulis Sallinens Musik ist auch hier modern, aber nie atonal, selten schroff. Es ertönen feingliedrige Klangskulpturen, die zu einem faszinierenden und kurzweiligen Ganzen zusammengefügt wurden. Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester besteht hier nur aus sieben Instrumentalisten. Als Gast spielt Christiane Lüder ein Akkordeon und verleiht damit der Musik einen ungewohnten Klang. Die Akkordeontöne wirken wie Sonnenstrahlen, die auf Dunkles fallen. Geleitet wird das Orchester vom jungen Sebastian Zierer, der mit einem großen Maß an Sensibilität die Musik zu kunstvollen Klanggebilden erhob.
Der mit Unterhemd und modernem Jackett gekleidete Barabbas des französischen Baritons Boris Grappe ist kein schnöder Haudegen, sondern ein kraftvoller und sensibler Mann. Dies auch in vokaler Hinsicht.
Vergleicht man Florian Plocks Portrait im Programmheft mit seiner Bühnenfigur des mit seinem Schicksal hadernden Judas, sieht man kaum Gemeinsamkeiten. Das Foto zeigt ihn klassisch, auf der Bühne ist der Bass als oberkörperfreier, ungestümer, roher Judas kaum wiederzuerkennen. „Das Mädchen“ gibt die Sopranistin Sun Hyung Cho, „den Jüngling“ der Tenor Simon Bode, beide wie Sharon Carty vom Frankfurter Opernstudio kommend.
Am Ende gab es nicht nur viel Applaus für die Sänger und die Musiker, sondern auch einen Extraapplaus für den anwesenden Komponisten Alus Sallinen.
Markus Gründig, Juli 11
Médée
Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot
Besuchte Vorstellung: 16. Juni 11
Medea am Anfang, Medea am Ende und auch bald schon wieder im Schauspiel. Die aktuelle Saison der Oper Frankfurt wurde mit der deutschen Erstaufführung von Ariberts Reimanns Oper „Medea“ eröffnet, als vorletzte Neuproduktion der vielseitigen Saison feierte jetzt im Bockenheimer Depot die Oper „Médée“ des französischen Barockkomponisten Marc-Antoine Charpentier Premiere (von Charpentier ist dessen Hauptthema aus dem Te Deum in D-Dur seit 1954 allgemein bekannt: als Eurovisions-Melodie).
Die Medea Inszenierung aus 2007 von Regisseur Urs Troller am Schauspiel Frankfurt mit Friederike Kammer und Oliver Kraushaar in den Hauptrollen war lange Zeit ein Publikumserfolg. Für die kommende Saison ist nun eine Neuinszenierung angekündigt, bei der Michael Thalheimer Regie führen wird, die Premiere ist für den April 2012 geplant. Was ist dran am Medea-Stoff, dieser selbstzerstörerischen Liebe, dass er immer wieder zu einer szenischen Umsetzung reizt? Ist es allein die Figur der liebenden Medea, die aus Eifersucht und Enttäuschung zur Mörderin ihrer Kinder wird? Oder die stille Sympathie für einen Mann wie Jason, der praktisch denkend sich jeweils an die beste Frau hängt?
Die Inszenierung von David Hermann gibt darauf zwar keine direkte Antwort, fasziniert aber allein schon durch ihre szenische Umsetzung, die publikumsgefällig der Barockoper jeden Staub nimmt. Für diese Neuinszenierung wurde im Bockenheimer Depot der Zuschauerraum um seitliche Flügel erweitert. Die Bühne zeigt in modernem Ambiente einen großzügigen Wohnloft, wie man sie sich auch aktuell in einem Gebäude des Frankfurter Westhafens vorstellen kann. Auf mehreren Ebenen verteilt gibt es einen Wohn-, Küchen-, Außen- und sogar einen Fitnessbereich mit einer Sprossenwand. Dazu passt dann auch die zeitgemäße Kleidung der Darsteller, schickes Abendkleid oder bequemer Freizeit- bzw. Sportanzug (Bühnenbild und Kostüme: Christof Hetzer). Fast könnte es sich auch um ein europäisches Haus der Wisteria Lane handeln, der Strasse aus der US-Serie „Desperate Housewives“, denn das Liebestechtelmechtel, wer mit wem und Intrigen hier wie dort, wird sehr aktuell vermittelt.

Oper Frankfurt
Médée (Anne Sofie von Otter)
Foto: Barbara Aumüller ~ szenenfoto.de
Glanzpunkte setzen die großartigen Stimmen und die genaue Zeichnung der Charaktere. Allen voran die schwedische Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter in der Titelrolle. Auf der diesjährigen Musikmesse wurde sie mit dem Frankfurter Musikpreis ausgezeichnet, im Oktober 2008 gab sie einen außergewöhnlichen Liederabend, bei dem sie von Bengt Forsberg (Klavier), Svante Henryson (Violoncello) begleitet wurde. Ihre Médée ist eine tief empfindende und liebende Frau, die bereit ist, für diese Liebe auch alles zu tun. Warm und glanzvoll klingt ihre Stimme, bei stets klarer und präziser Linienführung. Selbst wenn sie sich zum Ende als Priesterin des Todes gebiert (mit Unterstützung der Eifersuchts- und Racheboten Simon Bode [La Jalousie] und Vuyani Mlinde [La Vengeance]) fühlt man noch mit dieser starken Frau.
Glanzvoll auch Christiane Karg als bezaubernde Prinzessin Créuse, mit frischer Natürlichkeit und hoher technischer Souveränität. Souverän präsentieren sich auch Eun-Hye Shin (Nérine) und Sharon Carty (Cleone). Bei den Männern faszinieren neben den bereits erwähnten Gehilfen aus der Unterwelt die irdischen Gestalten König Créon (schön grundiert: Simon Bailey), Herzensbrecher Jason (mit üppigem tenoralem Schmelz: Julian Prégardien) und der gehörnte Oronte (Sebastian Geyer) im Mittelpunkt.
Der von Christian Rohrbach einstudierte Chor ist szenisch nicht eingebunden, gesungen wird mit Wohlklang seitlich vor der Bühne. Drittes Highlight, neben den Sängern und der szenischen Umsetzung ist die musikalische Begleitung durch das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Andrea Marcon. Das Orchester spielt in kleiner Besetzung auf historischen Instrumenten und mit Unterstützung durch Spezialisten des Ensembles Barock Vokal (vom Kolleg für Alte Musik ab der Hochschule für Musik Mainz).
So ist es kein Wunder, dass die knapp dreistündige Aufführung (inkl. einer Pause) wie im Fluge vergeht. Wobei das Stück etwas gekürzt wurde, hauptsächlich um den Prolog (dieser war zur Zeit der Entstehung ein Muss und diente in erster Linie zur Glorifizierung des Sonnenkönigs Ludwig XIV).
Alle weiteren Vorstellungen sind ausverkauft, das spricht für sich. Restkarten gibt es mit etwas Glück an der Abendkasse.
Markus Gründig, Juni 11
Kullervo
Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 12. Juni 11
Die Oper Frankfurt zeigt zum Saisonende als Frankfurter Erstaufführung nicht nur Aulis Sallinens Oper „Kullervo“, sie hat dem finnischen Komponisten (* 1935) auch den diesjährigen Schwerpunkt „Oper Finale“ gewidmet, bei dem viele Begleitveranstaltungen rund um diese Oper angeboten werden. „Kullervo“ ist Sallinens vierte Oper, sie entstand 1986-1988 als ein Auftragswerk der Finnischen Nationaloper und wurde 1992 in Los Angeles uraufgeführt.
Sallinens Musikstil verbindet neue und alte Klänge, bleibt dabei aber stets tonal. In ihrer Schroffheit klingt die Musik mitunter hart und heftig, dann umschmeichelt sie auch wieder die Ohren mit großen melodiösen Formen, die sich oft zu cineastischen Formaten aufbauschen. Der Neotraditionalist Sallinen hat ein großes Gespür für publikumswirksame musikalische Formen und beweist sich als Meister für politisches Volkstheater mit technischer Raffinesse.
Ein starker Text ist für ihn wichtige Voraussetzung für eine Opernkomposition und so verfasste er für „Kullervo“ das Libretto selber. Dabei nahm er auf zwei Quellen starken Bezug: das von Elias Lönnrot im 19. Jahrhundert niedergeschriebene finnische Nationalepos „Kalevala“ (für die vom Chor gesungenen mythologischen Elemente) und das Kullervo-Drama des finnischen Nationaldichters Aleksis Kivi (dem der Aufbau des Librettos nachempfunden ist; die Kullervo-Legende ist ein Teil der Kalevala). Die Dialoge schrieb Sallinen selber.
Von Aufklärung, Rechtstaatlichkeit und Anstand ist bei „Kullervo“ noch nichts zu spüren, die Welt ist wie im frühen Mittelalter: brutal, heidnisch und primitiv. Raue Sitten herrschen in dieser Gesellschaft, wo jeder für sein eigenes Recht sorgt. Raub, Rache und Totschlag sind an der Tagesordnung. Wer nicht mithalten kann, wird zum Sklaven. Freiheit adé. Kullervo kann ein Lied davon singen. Schon als Kind durch die Ermordung der Eltern und Brandstiftung des Elternhauses traumatisiert, gibt es für ihn keine Chance auf eine Resozialisierung. Er befindet sich als Ausgestoßener, der nie Liebe und menschliche Zuwendung erfahren hat, in einem Kreislauf aus roher Gewalt und Hass, aus dem er nicht heraus kommt, der mehr und mehr Menschenleben zerstört, bis er sich schließlich für den Freitod entscheidet, denn im Jenseits kann für ihn das Leben nicht schlimmer sein als auf Erden.
Die Oper bietet eine packende Geschichte, die trotz ihres archaischen Charakters viele Bezüge zur Gegenwart aufweist: Missbrauch Schutzbefohlener, Rache und Gewalt anstelle von Konfliktlösungen in den Krisengebieten der Welt… Wenige Wochen nach der Uraufführung fanden am Ort der Uraufführung Unruhen mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen statt (die so genannten „Los Angeles Riots“, die 53 Todesopfer forderten.
Dabei ist Kullervo ein Actionheld, den auch Hollywood groß in Szene setzen könnte. Regisseur Christof Nel (der in Frankfurt u.a. schon Strauss’ „Die Frau ohne Schatten“ und Wagners „Tristan und Isolde“ inszenierte) nutzt die große Bühne nur partiell. Überwiegend wird die Oper fast kammerspielartig präsentiert. Bühnenbildner Jens Kilian schuf im hinteren Bühnenbereich ein hölzernes Gebilde aus großen, beweglichen Quadern. Die Beleuchtung ist der Grundstimmung angepasst äußerst dezent. Der Hintergrund bleibt dunkel, Licht gibt es nur vorne, oftmals als Spot auf die Darsteller. So ergibt sich eine ganz besonders intensive Atmosphäre (Licht: Olaf Winter). Den Kostümen von Ilse Welter nach spielt die Oper in den 1960er Jahren.
Trotz dem, das übliche Operndrama überbietende, extreme Geschehen von „Kullervo“, finden auf der Bühne gar nicht so viele abgründige Szenen statt, wie man erwarten könnte. Nel verlangt den Sängern vielmehr ein großes Maß an schauspielerischem Können ab, um die Schwere der Seelennöte ihrer Figuren offen zu legen.
Mit Feuer beginnt und endet die Geschichte. Der Brand des Elternhauses zu Beginn wird mittels einer Projektion auf einen Gazevorhang angedeutet. Kullervos finaler Selbstmord ist als mahnendes Bild von großer, bedrückender Intensität: Menschliche Körper bilden die Flammen, denen Kullervo sich hingibt und die ihn vernichten. Neben dem Feuer ist ein Stein ein weiteres Symbol dieser Oper. Ein Stein wurde Kullervo ins Brot gebacken. An diesem Stein zerbricht sein Messer, sein einziges Erinnerungsstück an den für tot geglaubten Vater (despotisch: Alfred Reiter), womit auch noch die letzte Verbindung zur Familie zerstört wurde. So wird der Stein zum Symbol der Härte, der ihm sein Leben lang anstelle eines Herzens auf die Brust drückt. Der britische Bariton Ashley Holland bietet ein überaus intensives Rollenporträt, als Leidender, Kraftvoller und doch endlos Strauchelnder und besticht auch vokal bei dieser schwierigen Rolle.
In dieser dunklen, kalten Welt gibt es aber auch noch andere Seiten. Wie die selbstlose Liebe der Mutter, die trotz alledem um ihn weinen wird (von Heidi Brunner eindringlich verkörpert), Kullervos versteckte Liebe zur jungen Frau des Schmiedes (elanvoll: Jenny Carlstedt) oder seine Beziehung zu seinem fürsorglichen Kindheitsfreund Kimmo (mit wunderbar strahlendem tenoralen Glanz: Peter Marsh).
Die weiteren Rollen sind mit den besten Mitgliedern des Ensembles besetzt und gefallen uneingeschränkt (Frank van Aken als Jäger, Katharina Magiera als Untos Frau, Franz Mayer als Unto und Barbara Zechmeister als Schwester). Der von Matthias Köhler einstudierte Chor hat hier viele Passagen zu bewältigen, wobei gerade in den ersten Szenen der Damenchor eine deutlich stärkere vokale Leistung bot. Vom benachbarten Schauspiel Frankfurt wirkt bei dieser Produktion der Schauspieler Christoph Pütthof („Phädra“, „Der Nackte Wahnsinn“, „Das Weiße Album“) mit, der nicht zuletzt mit seiner Erfolgsreihe „Karaoke mit Pütti“ auch schon seine gesangliche Qualität unter Beweis stellte. Hier ist er der Blinde Sänger und bietet eine coole, eigenständige Performance innerhalb der Oper.
Gesungen wird, zeitgemäßen Gepflogenheiten zum Trotz, nicht in der Originalsprache, sondern auf deutsch (wie bei der Deutschen Erstaufführung im Februar 2001 in Lübeck). Die finnische Sprache hat durch ihren konsonantenarmen Lautstand eine ganz eigene Klangmelodie, weshalb die Texte nicht einfach eins zu eins übersetzt werden konnten. Als Zuschauer profitiert man stark von der deutschen Fassung, die unter Sallinens Mitwirken entstand, zumal sehr klar gesungen wird (zusätzlich gibt es Übertitel). Eine Freude ist allein aber auch schon die Musik, die vom Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Hans Drewanz überaus farbenreich und plakativ aufgefächert wird. Neben den vielen expressiven Momenten gibt es auch viele überaus poetische. Drewanz, ehemaliger Darmstädter Generalmusikdirektor, dirigierte das Werk bereits vor fünf Jahren bei der Schweizer Erstaufführung in Bern (dort wurde die Oper auf finnisch gegeben).
Markus Gründig, Juni 11
Luci mie traditrici
Oper Fankfurt im Bockenheimer Depot
Besuchte Vorstelllung: 15. Mai 11
Der im Jahr 1947 geborene italienische Komponist Salvatore Sciarrino hat es geschafft, eine ganz eigene musikalische Sprache zu entwickeln. Er ist zwar noch nicht so bekannt wie ein Peter Eötvös, Detlev Glanert oder Aribert Reimann, dafür sind immerhin drei seiner Werke auf aktuellen Spielplänen vertreten. Die Oper Frankfurt zeigt in Zusammenarbeit mit dem Musikfestival Cantiere Internazionale d´Arte di Montepulciano im Bockenheimer Depot derzeit die 1988 in Schwetzingen uraufgeführte Oper „Luci mie traditrici“. Im Nationaltheater Mannheim wird am 20. Mai 11 Sciarrinos Oper „Superflumina“ uraufgeführt und im Staatstheater Mainz hat am Tag darauf die Oper „Macbeth“ aus dem Jahr 2002 Premiere.
Wer bei Oper an großes Orchester, an ausschweifende Klangeskapaden oder schmachtende Arien denkt, sollte für Scarrino seinen Horizont erweitern. Denn klassischen Hörerwartungen entspricht diese einzigartige Musik nicht. Salvatore Sciarrino ist vielmehr ein Großmeister der stillen und zum Teil ungewöhnlichen Töne. Mit zarten Klangfarben und Klangverfremdungen legt er seelische Zustände offen und erzeugt damit ein Höchstmaß an Spannung. Gleichzeitig wird die Sprache und die Musik auf das Wesentlichste reduziert.
Die seiner Oper „Luci mie traditrici“ (in etwa:“ Das trügerische Auge“) zugrunde liegende Geschichte des mordenden Ehemannes, basiert auf einer wahren Begebenheit (dem von Carlo Gesualdo, Komponist und Fürst von Venosa, durchgeführten Ehrenmord an seiner Frau und deren Liebhaber).
Die jetzt im Bockenheimer Depot zu sehende Produktion feierte im vergangenen Sommer ihre Premiere bei der Sommerakademie (und gleichzeitigem Musikfestival) „Cantiere Internazionale d’Arte“ im italienischen Montepulciano (Toskana), das 1976 von Hans Werner Henze ins Leben gerufen wurde. Für die szenische Gestaltung zeichnet das Team Christian Pade (Inszenierung) und Alexander Lintl (Bühnenbild und Kostüme) verantwortlich. Beide sind in Frankfurt keine Unbekannten (The Turn of the Screw, Chowanschtschina, Pique Dame, Caligula).
Für die Szenen, die an nur einem Tag im Garten und dem Schlafgemach spielen, wurde eine schlichte und dennoch imposante Einheitsbühne geschaffen. Drei hohe Gebilde, Schuppen ähnliche Raumobjekte mit Wänden aus Holzlatten, imaginieren einen gewissen Gartenbezug und deuten gedreht und unterschiedlich ausgeleuchtet, jeweils verschiedene Bereiche an. Es sind Schutzräume mit offenen Eingängen, in die hinein wie hinausgeschaut werden kann. Zum Ende hin werden sie auf die Rückseiten gedreht und zeigen dann nahezu flächig ausgefüllte Wände für den Innenbereich. Die Personenführung durch Pade ist trotz nahezu pantomimischer Bewegungen im Vergleich zur Musik lebendig und plakativ.
Zusätzlich werden die Charaktere durch die Kostüme untermalt. Wie bei Il Malaspina, der gleich zu Anfang in Kutte und mit großem Schwert (mit dem er später dem Liebhaber die Gliedmaße abschlagen wird) auftritt. Oder wie beim Liebhaber, in hellem und luftigem Outfit. Doch geht es bei den acht Szenen weniger um die eigentliche Geschichte, die schnell erzählt und von Anfang an bekannt ist. Interessant ist vielmehr, wie intensiv die Unmöglichkeit erfüllter Liebe hier vorgeführt wird und das nicht alles so ist, wie es scheint. Der deutsche Titel der Oper („Die tödliche Blume“) nimmt Bezug auf die Rose, an dessen Dorn sich die La Malaspina sticht, wobei die Rose hier symbolisch für das weibliche Geschlecht steht, das dem Mann zum Verhängnis wird.
Die vier Sänger und das von Kapellmeister Erik Nielsen geleitete reduzierte Frankfurter Opern- und Museumsorchester vollbringen Großes und erheben Sciarrinos feinziselierenden musikalischen Kosmos zum Kosmos des Publikums. Das Orchester, fast ausschließlich im Piano spielend, kreist mit zupfenden Geigen, mit Luft hauchenden Posaunen und schwingendem Donnerblech um den artifiziellen Text, der in seiner Widersprüchlichkeit vor allem Bewusstseinsströmungen verkörpert. Die Sänger stammen zum einen vom Frankfurter Opernstudio (Nina Tarandek als La Malaspina und Simon Bode als Diener) oder sind als Gäste an dieser Prodkktion beteiligt (Countertenor Roland Schneider als L´Ospite und Christian Miedl als Il Malaspina).
Die Oper bietet innige, betörende, mitunter auch verstörende, auf jeden Fall anregende 70 Minuten, die moderne Musik im Spiegel der alten Musik zu einem neuen Klangerlebnis erhebt.
Mit Aulis Sallinens „Kullervo“ hat im Juni ein weiteres und zu „Luci mie traditrici“ sehr konträres Werk der Moderne Premiere (dann im Opernhaus).
Markus Gründig, Mai 11
Murder in the Cathedral
Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 5. Mai 11
Fahrstuhl zur Heiligsprechung
Selten gespielte Opern auf die Bühne zu bringen ist das Eine. Sie aber dabei auch noch richtig groß herauszubringen (wie z.B. eine Mozart-, Verdi- oder Wagneroper), ist das Andere. Für die deutsche Erstaufführung von Ildebrando Pizettis völlig unbekannter Oper „Murder in the Cathedral“ (englische Fassung von Geoffrey Dunn) scheute die Oper Frankfurt weder Kosten noch Mühen. Die Inszenierung wartet mit einem fast schon verschwenderischen Choraufgebot, einem großartigen Bühnenbild, einem Starregisseur und einem starken Sängerensemble auf, das alles allein ist schon überaus bemerkenswert!
Ildebrando Pizetti (1880 – 1968) gilt als Mitbegründer der neueren italienischen Musik.
Von atonaler Musik, Zwölftontechnik etc. ist sein Musikstil jedoch weit entfernt. Er wendete sich bewusst vom vorherrschenden Verismus Italiens ab und schuf, vom Gregorianischen Choral ausgehend, eine neue Kantabilität (in der die Unterschiede von Dramatik und Lyrik aufgehoben sind). Dies einmal live hören zu können ist ein weiterer Vorzug dieses Programmpunkts im Spielplan der Oper Frankfurt.
Das jetzt hier die englischsprachige Fassung und nicht die italienische („Assassinio nella cattedrale“) gezeigt wird hängt damit zusammen, dass die Oper auf dem gleichnamigen geistlichen Spiel des amerikanisch-englischen Schriftstellers T.S. Eliot beruht. Wobei die Oper auch „Thomas Becket“ hätte heißen können. Denn um ihn, den ehemaligen Lordkanzler und Erzbischof dreht sich das Geschehen. Er wurde im Jahr 1170 in der Kathedrale von Canterbury ermordet (und schon drei Jahre später heilig gesprochen). Formal handelt die Oper von seinen letzten Tagen im Dezember 1170, von den Prüfungen, denen er ausgesetzt war und seiner Ermordung durch die Ritter des Königs Heinrich II. Inhaltlich geht es um die Funktion des Martyriums und die Beweggründe des Märtyrers.
Regisseur Keith Warner (La Cenerentola, Volo di notte, Il prigioniero, Macbeth, Death in Venice, Lear, The Tempest) verlegte das Geschehen in die Entstehungszeit der Oper, also in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Zusammen mit Bühnenbildner Tilo Steffens wurde für diese Inszenierung kein kirchlicher Raum gewählt, sondern ein vertikal gekippter, nach hinten sich verengender riesiger Aufzugsschacht! Das passt sogar gewissermaßen zu Frankfurt, einer Stadt, die als einzige in Europa eine Skyline von Hochhäusern bietet. Es ist schon ein wenig verwunderlich, dass bisher so etwas noch nicht zu sehen war.
Die Perspektive ist freilich ungewöhnlich, zumal es zahlreiche Geschosse in Form von vertikalen und horizontalen Türflügeln gibt. Der sich während der Aufführung immer weiter nach hinten verschiebende Boden dient gleichzeitig als ein Eintrittsportal. Wo geht die Fahrt mit dem imaginären Aufzug hin? Ist es eine Fahrt zur Hölle oder in den Himmel? Wohin steuert die Gemeinde der Gläubigen, wer lenkt sie? Viele Assoziationen sind für dieses Bild des Aufzugs denkbar.
Über eine große, von der Decke herabsinkenden Treppe, kommt Thomas Becket von der Außenwelt in diesen Raum hinein (und entschwindet am Ende über sie). Sir John Tomlinson gibt mit dieser Rolle sein Debüt an der Oper Frankfurt. Er füllt sie nicht nur mit großer Autorität aus, sondern vor allem auch mit seiner großen und fundiert sitzenden Stimme. Die kräftezehrende Gesangspartie meistert er glänzend und mühelos, bei gleichzeitig sehr intensivem Spiel. So wundert es nicht, dass beim Schlussapplaus nicht nur das Publikum, sondern auch die Kollegen auf der Bühne applaudierten.
Neben der Figur des Thomas Becket gibt es fast nur repräsentative Figurengruppen (keine wirklich weiteren Charaktere). Wie die drei Priester (Hans-Jürgen Lazar, Vuyani Mlinde, Dietrich Volle), die vier Versucher/vier Ritter (Magnus Baldvinsson, Simon Bailey, Brett Carter, Beau Gibson) und die Frauen von Canterbury (den Chor; mit den Chorführerinnen Katharina Magiera und Britta Stallmeister) und einen Herold (Michael McCown). Gesungen wird auf gewohnt hohem Niveau, bei den Einzelstimmen und bei dem von Michael Clark einstudierten Chor. Klangschön agiert das Frankfurter Opern- und Museumsorchester, bei dieser Produktion unter dem Dirigat von Martyn Brabbins.
Zusammen mit der die Stimmung gut wiedergebenden dunklen Ausleuchtung von Olaf Winter und den Kostümen von Julia Müer (auffallend die britisch-gelben Mäntel der Ritter) schuf Keith Warner vielfältige, faszinierende Bilder und überzeugte mit seiner genauen Personenführung, die nichts dem Zufall überließ. So holte er ein Maximum an dramatischem Geschehen heraus. Sei es mit dem, im seitlichen Kanalschacht, lauernden Männerchor, Dekonstruktion einer Christusstatue oder dem Herausreißen von Thomas Beckets Herz. Nachdem sich des Königs Schergen für ihre Tat wie moderne Politiker gerechtfertigt haben und ein TeDeum erklingt, blickt Thomas Becket als bereits Entrückter zurück. Viel Beifall.
Markus Gründig, Mai 11
Die Feen
Oper Frankfurt
Konzertante Aufführung der Oper Frankfurt in Koproduktion mit der Alten Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 3. Mai 11
Mit seinen großen Opern und der Ring-Tetralogie gilt Richard Wagner unumstritten als Meister und Wegbereiter der Musik. Doch das war nicht immer so. Auch sein Lebensweg war von Hindernissen und Problemen gezeichnet. Schon in jungen Jahren verfasste er ein Textbuch zu seiner geplanten Oper „Die Hochzeit“. Seiner Schwester Rosalie, angesehene und einflussreiche Schauspielerin in Leipzig, missfiel jedoch das Sujet der Oper und das Textbuch, worauf Wagner die komplette Oper verwarf. Bis auf die Namen von vier Personen. Diese übernahm er in sein nachfolgendes Projekt „Die Feen“. Es beruht auf der Fiaba teatrale La donna serpente (1762) von Carlo Lucio Graf Gozzi in der Übersetzung von Friedrich August Clemens Werthes(1779). Gozzi verdankt die Welt übrigens weitere Opern: So komponierte Prokofjew eine Opernfassung von dessen „Die Liebe zu den drei Orangen“ und Puccini zu dessen „Turandot“.
Die Uraufführung der 1833 (Kompositionsentwurf) bzw. 1834 (Partitur) fertiggestellten „Feen“, sollte ursprünglich in Wagners Geburtsstadt Leipzig stattfinden. Warum sie schließlich dort aber nicht erfolgte, ist nicht vollständig geklärt bzw. findet sich Widersprüchliches darüber. Zumindest der Kapellmeister Ferdinand Stegmayer vom Theater Leipzig soll dem Werk zugetan gewesen sein. Einwände erhoben aber wohl vor allem der Theaterdirektor Friedrich Ringelhardt und der Regisseur Franz Hauser. 1835 gab Wagner das Vorhaben auf, die Oper in Leipzig uraufzuführen. Auch Versuche, sie in Prag und Magdeburg aufzuführen, scheiterten. In der Sachsen-Anhaltischen Ottostadt wurde lediglich im Januar 1835 in der Freimaurerloge die Ouvertüre erstmalig gespielt. Viele Jahre vergingen. 1887 entstand ein Klavierauszug und ein Jahr später fand dann endlich die Uraufführung im Königlichen Hof- und Nationaltheater München statt (fünf Jahre nach Wagners Tod).
Bis heute ist die Oper weitestgehend unbekannt geblieben. Zu seiner 200-Jahr-Feier zeigte das Mainfranken Theater in Würzburg „Die Feen“ szenisch (Februar 2005), im gleichen Jahr gab es eine szenische Aufführung im Pfalztheater Kaiserslautern und im März 2009 die französische Erstaufführung in Paris (im Théâtre du Châtelet). Jetzt waren „Die Feen“ zumindest als konzertante Aufführung in der Alten Oper Frankfurt zu erleben (in Koproduktion mit der Oper Frankfurt).
Auch wenn die stilistisch uneinheitliche Oper Züge eines Jugendwerkes trägt, lässt sie doch schon vieles vom späten Wagner erkennen. Die Nähe zur deutschen romantischen Oper, zur Musik von Carl Maria von Weber, Ludwig van Beethoven und Heinrich Marschner, sind unverkennbar. Neu ist die instrumentale Prägung einzelner Nummern, ein ausgeprägter Szenenbezug der Musik und ein ausgeprägter Sinn für theatralische Wirksamkeit. Allerdings ist die Musik hier noch gewissermaßen gebremst: „Ihm fehlte noch das unbedingte Vertrauen auf die poetische Allmacht der Musik, die Sorge um musikalischen Ausdruck wirkt hemmend auf die Dichtung“ (H. S. Chamberlain über Wagners Musik in „Die Feen“).Wenn schon die Ouvertüre fast eine Viertelstunde dauert, ist die ganze Oper natürlich auch nicht in einer Stunde abgespielt. Auch diesbezüglich zeigt sich Wagner in diesem Werk schon als ausgedehnter Erzähler: Die Oper dauert gute drei Stunden. Dabei hat Wagner nicht nur den in Gozzis Vorlage vorhandenen Bereich der Commedia dell’ arte vollständig eliminiert, sondern der Geschichte auch ein anders Ende gegeben.

Oper Frankfurt / Alte Oper Frankfurt
v.l.n.r. Matthias Köhler (Chordirektor), Sebastian Geyer (Harald), Anja Fidelia Ulrich (Zemina), Juanita Lascarro (Farzana), Christiane Karg (Drolla), Brenda Rae (Lora), Tamara Wilson (Ada), Sebastian Weigle (Generalmusikdirektor), Thorsten Grümbel (Gernot), Simon Bode (Gunther / Ein Bote) und Michael Nagy (Morald) sowie Frankfurter Opern- und Museumsorchester und Chor der Oper Frankfurt; rechts oben sitzend Simon Bailey (Stimme des Zauberers Groma)
© Wolfgang Runkel
Für die konzertanten Aufführungen wurden exzellente Sänger verpflichtet, sowohl als Gäste als auch aus dem Ensemble. In der Hauptrolle der Fee Ada gab die amerikanische Sopranistin Tamara Wilson ihr Debüt an der Oper Frankfurt. Wobei es nicht nur ihr Frankfurt-, sondern sogar ihr Deutschlanddebüt war. So textverständlich wie sie auf Deutsch gesungen hat, ist das kaum zu glauben. Sie verfügt über schier unendliche Kraft für die anstrengende Partie und meisterte die vielen dramatischen Ausbrüche bravourös. Burkhard Fritz, Ensemblemitglied der Berliner Staatsoper war leider kreislaufmäßig angeschlagen. Das war stimmlich zwar nicht zu hören, er glänzte mit seinem tenoralen Schmelz in der Rolle des Arindal. Allerdings erlitt er während des dritten Aktes hinter der Bühne einen Kreislaufzusammenbruch, sodass dieser nicht unwichtige Akt (bei dem Wagner Gozzische Märchen mit dem Orpheus-Mythos verband) leider nur teilweise gespielt werden konnte.
Mit starker Präsenz und Stimme präsentierte sich der glänzend aufgelegte Bariton Michael Nagy in der Rolle des Schwagers und späteren Königs Morald. Im Sommer wird er erstmal den Wolfram im Bayreuther Tannhäuser singen (zu schade, dass er ab der kommenden Saison nicht mehr Ensemblemitglied der Oper sein wird und als freier Sänger arbeiten wird). Als dessen Schwester Lora betörte Brenda Rae. Fast schon etwas operettenhaft wirkte die Liebesszene zwischen Drolla (Christiane Karg) und Gernot (Thorsten Grümbel): ein amouröses füreinander Schwärmen (wobei der Mangel an gegenseitigem Vertrauen und der Sieg der Liebe ja das Hauptthema der Oper ist). Als weitere Feen wirkten Juanita Lascarro (Farzana) und Anja Fidelia Ulrich (Zemina) mit, als Feenkönig Alfred Reiter. Sebastian Geyer überzeugte bei seinem kurzen Auftritt als Harald. Nicht unerwähnt sollte Simon Bode vom Opernstudio Frankfurt bleiben, der als Gunther und Bote sehr klangschön sang.
Der von Matthias Köhler einstudierte Chor präsentierte sich in großer Besetzung mit verve. Generalmusikdirektor Sebastian Weigle erweiterte mit „Die Feen“ sein Repertoire an Wagner Opern. Mit einem intensiven Gespür für musikdramatische Momente (inklusiver Pausen, wie die, nachdem Arindal Ada verflucht hat) leitete er das formidabel aufspielende Frankfurter Opern- und Museumsorchester.
Die Aufführung wurde von Oehms-Classic aufgezeichnet und kann in einigen Monaten als CD erworben werden.
Die Vorstellung selten gespielter Wagner Opern wird fortgesetzt. In weiteren Koproduktionen der Oper Frankfurt und der Alten Oper Frankfurt wird in der Saison 2011/2012 „Das Liebesverbot“ und in der Saison 2012/13 „Rienzi, der letzte der Tribunen“ konzertant aufgeführt.
Markus Gründig, Mai 11
Tristan und Isolde
Oper Frankfurt
Wiederaufnahme Saison 2010/11
Besuchte Vorstellung: 3. April 11
Manchmal kommt es anders, als man denkt. Eigentlich sollte „Tristan und Isolde“ ein leicht zu inszenierendes Werk für jede Bühne werden. Herausgekommen ist ein nahezu unaufführbares Stück, das die Grenzen von Oper und Musiktheater in allen Dimensionen zu sprengen droht. Für manche ist es gar schlicht ein „Geschenk des Himmels“. Dabei war, wie Dramaturg Zsolt Horpácsy schon im Begleittext zur Neuinszenierung von 2003 hinweist, der Entstehungsprozess durchaus irdisch (weil aus finanziellen Nöten heraus, begleitet von persönlichen Liebesumständen Wagners). Regisseur Christof Nel und Bühnenbildner Jens Kilian (mit Vera Nemirova auch für den neuen Frankfurter „Ring“ verantwortlich), fanden für die szenische Umsetzung karge Räume, in denen sich die Protagonisten sehr zurückhaltend bewegen.
Entstanden ist dadurch ein bedrückendes Bilderalbum, das einen intensiven Blick auf die tiefe Gefühlswelt der Figuren richtet. Erlösung, Liebe und Erfüllung sind hier nur im Tod erreichbar. So korrespondiert das anfangs helle und erhobene Bühnenbild trefflich zur Musik, um am Ende dann in eine fast schon apokalyptische Düsternis überzugehen.
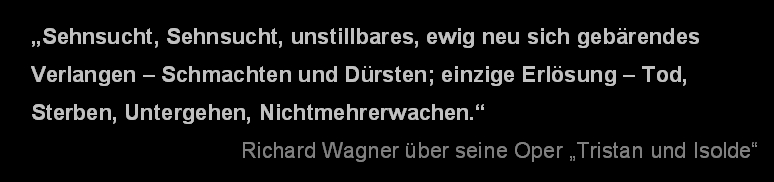
Die Premiere von „Tristan und Isolde“ in der Inszenierung von Christof Nel fand am 25. Mai 2003 statt, in der ersten Saison von Intendant Bernd Loebe. Nach langer Pause, die erste Wiederaufnahme gab es im Juni 2005, wurde die Oper jetzt für insgesamt fünf Vorstellungen zum 2. Mal wieder aufgenommen. Bis auf Michael McCown als tänzelnder Hirt wurden dabei alle Rollen neu besetzt und auch die musikalische Leitung ist eine andere. Statt Paolo Carignani dirigiert für diese Aufführungsserie Generalmusikdirektor Sebastian Weigle das Frankfurter Opern und Museumsorchester. Weigle hat sich als Wagnerdirigent längst einen Namen gemacht. Viel Lob gab es für seine Umsetzung von „Das Rheingold“ und „Die Walküre“, die mit Spannung die beiden fehlenden Frankfurter Ring-Teile („Siegfried“ und „Götterdämmerung“) erwarten lassen. Kaum eine Wagner Oper, die er noch nicht dirigiert hat (selbst die selten gespielte „Die Feen“ wird derzeit vorbereitet, Premiere der konzertanten Aufführung ist bereits am 3. Mai 11 in der Alten Oper Frankfurt). Bei den Bayreuther Festspielen wird er auch dieses Jahr wieder „Die Meistersinger von Nürnberg“ dirigieren.
So wundert es nicht, dass auch diese „Tristan“-Aufführung von einem außerordentlich klangschönen Orchesterspiel begleitet und untermauert wird. Schließlich spielt die Musik für die Vermittlung von Gefühls- und Seelenzuständen hier, wie in kaum einem anderen Werk, eine eminent wichtige Rolle. Ein Rausch an Emotionen strömt aus dem Orchestergraben, mit feiner Zurückhaltung bei den expressiven Momenten und mit viel Sinn für all das in den Noten liegende Abgründige. Insbesondere beim dritten Akt entfaltet das Orchester einen suggestiven Klangrausch für den Ausdruck des Schmerzes und des Leids, für unstillbare Liebessehnsucht und grenzenloses Todesverlangen.
Mit Catherine Foster und Frank van Aken verführte ein gestandenes Sängerpaar die Ohren der Zuschauer. Foster, Ensemblemitglied des Nationaltheaters Weimar, gab zwar hier ihr Rollendebüt, allerdings verkörperte sie in Weimar bereits schon alle drei Ring-Brünnhilden. Sie verfügt über die für diese Rolle nötige „Hochdramatische“ Stimme. Und meisterte alle Hürden scheinbar mühelos. Mit viel Kraft und Ausdauer, differenziert und farbenreich, zeigte sie das Bild einer starken, aber auch verletzten Frau.
Die überaus anspruchsvolle, ja fast mörderische Rolle des Tristan wurde mit Frank van Aken besetzt. Seit der Saison 2006/07 ist er Ensemblemitglied der Oper Frankfurt. Aken, der zuletzt als Siegfried (Die Walküre) und Hagenbach („La Wally“) zu erleben war, verfügt über genügend stimmliches Volumen, um sich gegenüber dem großen Orchester zu behaupten. Er bot bis zum Ende stählern blitzenden Stimmglanz und betörte in den lyrischen Abschnitten.
Mit viel stimmlichem Volumen wartete auch Claudia Mahnke als Brangäne auf. Sie führte ihre Stimme sehr kontrolliert und kultiviert. Simon Neal gab den Kurwenal als Mann der Tat, voller Elan. Auch vokal glänzte er bei seinem Rollendebüt mit baritonalem Schmelz. Erhaben präsentierte Alfred Reiter mit klangschönem Baß den König Marke. In den kleineren Rollen überzeugten Julian Prégardien als jugendlicher Seemann, Toby Girling vom Frankfurter Opernstudio als Steuermann und Dietrich Volle als Melot.
Die vier weiteren Vorstellungen für dieses Meisterwerk finden am 8., 17., 22. und 25. April 2011 statt.
Markus Gründig, April 11
Tiefland
Staatsthaeter Mainz
Besuchte Vorstellung: 26. März 11 (Premiere)
Sie heißen Natascha (aus Wien), Elisabeth (aus Amstetten) oder Jasmin und Björn (aus Fluterschen), die Missbrauchsopfer der jüngsten Zeit. Trotz aller modernen Zeiten kommt es immer wieder zu Missbrauch von Menschen. Die Realität steht diesbezüglich der Fiktion nicht einmal nach. Schon d´ Alberts 1903 uraufgeführte Oper „Tiefland“ handelt von einem Missbrauchsopfer: Marta. Aus Praktikabilitätsgründen soll sie mit Pedro verheiratet werden. Ihr Peiniger Sebastiano, der sie seit der Kindheit missbraucht hat, hat auch vor, dies nach der Hochzeit zu tun, selbst in der Hochzeitsnacht. Ein hochaktuelles Thema also. Das Inszenierungshauptaugenmerk auf Martha zu richten, so wie es jetzt am Staatstheater Mainz die Wagner Urenkelin Katharina Wagner getan hat, ist insofern nicht verwunderlich. Eher, dass es so lange gedauert hat und dass es dazu einer Frau bedurfte. Oftmals lag der Schwerpunkt auf dem naiven Hirten „Pedro“ und dem Konflikt zwischen reiner Bergwelt und niederer Unterwelt (was vielleicht auch daran liegt, dass in der Oper der Missbrauch nur indirekt zutage kommt).

Staatstheater Mainz
Rosalina (Katherine Marriott), Marta (Sonja Mühleck), Sebastiano (Heikki Kilpeläinen)
Foto: Martina Pipprich ~ martina-pipprich.de
Diese Thematik stellt Katharina Wagner aber in den Hintergrund. Für die spanischen Pyrenäenwelt Pedros findet sich auf der Bühne lediglich eine kleine weiße Zeltpyramide. In diesem abstrakten, reinen Schutzraum hält sich Pedro auf, die Außenwelt kann zwar mit ihm kommunizieren, aber ihn nicht wirklich erreichen. So bleiben die Arme des Hirten Nando (fundiert: Alexander Kröner) stets im Stoff stecken. Einzige Genossen sind ihm ein paar Ziegen und ein Stoffhund, Sinnbild für sein kindliches Gemüt. Mit drei herabschwebenden, herzförmigen Sesselliftsitzen wird der Übergang vom Vorspiel zum 1. Akt eingeleitet. Das Pyramidenzelt entrückt in die Höhe, verschwindet aber nicht ganz. Dennoch bleibt die alte Heimat für Pedro künftig unerreichbar.
Nach einer Mühle, in der die meiste Handlung eigentlich spielt, sucht man im Bühnenbild von Monika Gora vergebens. Die Handlung wurde in einen geschlossenen Vergnügungspark verlegt, ohne sie zeitlich zu fixieren. Mit einer großen, mit Christuskreuzen verzierten, Riesenradgondel, einem Eisverkäufer in einem angemalten Müllcontainer, einem geheimnisvollen Turm, einer verschlossenen Eingangsfassade eines Fahrgeschäfts, einer mobilen Wand für einen Messerwurfartisten, bis über den Bühnenrand geführte bunte Lichterketten und einem artifiziellem leuchtendem Herz, das über alledem schwebt. Welches Kind träumt nicht von solch einem Park, wo die Welt jeglicher Probleme enthoben zu sein scheint und wunderbare Dinge den Alltag vergessen lassen. Kein Kuriosum also, dass Marta in dieser bunten und künstlichen Welt ihre Zuflucht sucht.
Ihre Mitmenschen sind nicht viel unschuldiger als der brutale Sebastiano. Sie liegen entweder (in Form von lebensechten Puppen) besoffen auf einer Treppenanlage herum und schlafen ihren Festzeltrausch aus, heizen die Stimmung an oder schauen betreten weg. Der von Sebastian Hernandez-Laverny bestens einstudierte Chor engagiert sich dabei mit großer Spielfreude. Wie generell das Sängerensemble glänzt, vor allem mit einer sehr guten Textverständlichkeit.
Die Hauptrolle der Marta ist mit Sonja Mühleck als Gast besetzt. Sie war von 2005 bis 2009 Ensemblemitglied der Oper Frankfurt und debütierte im Sommer 2007 als Gerhilde in „Die Walküre“ bei den Bayreuther Festspielen. Optisch wirkt sie in ihrem einfachen Rock und tief ausgeschnittenem Pullover wie eine geschundene Magd, ihre rote Haarpracht gibt ihr Stärke und Würde. Sie verfügt über eine reichhaltige, dramatische Stimme, legt aber auch als Gebrochene und Perspektivlose viel Ausdruck in ihren Monolog mit lyrischen Passagen („Ich weiß nicht, wer mein Vater war“). Wenn sie sich in eine heile Welt zurücksehnt, tauchen als Alter Ego bis zu drei kleine Kinder auf, die allesamt wie sie aussehen. Später schafft Marta es gemeinsam mit Pedro, zwei von ihnen zu beerdigen, so kommt es zumindest zu einer Teilbewältigung der schlimmen Vergangenheit.
Der Pedro des Alexander Spemann ist hier facettenreicher angelegt als sonst meist üblich. Auch er hat wohl eine traumatisierte Kindheit: Während seiner Wolfserzählung („Schau her, das ist ein Taler“) ist er beinahe wie von Sinnen und fuchtelt dabei mit seinen Armen wild herum. Spemann gibt ein authentisch anmutendes Bild des Pedro ab, verfügt über viel vokale Substanz und heldischen Glanz. Vorzüglich auch der Sebastiano des Heikki Kilpeläinen (der in weiteren Vorstellungen mit Thomas de Vries alternieren wird). Wäre man im Kindertheater, so würde er am Ende vom jungen Publikum ausgebuht werden (weil er so vortrefflich den Fiesling gegeben hat). Die Missbrauchsthematik spiegelt sich auch in seinem Erscheinungsbild: In weiten Teilen trägt er ein päpstliches Gewand und die für den Papst eigenen roten Schuhe. Mit den Vorfällen im Canisius-Kolleg in Berlin begannen Ermittlungen über Priester auf Abwegen und bei Wikipedia gibt es eine umfangreiche Seite zum Thema „Sexueller Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche“.
Die Brutalität seines rücksichtslosen Vorgehens klingt auch stimmlich vorbildlich an: kraftvoll und bestimmt, wie ein fliegendes Messer auf der Zielgeraden (eine diesbezügliche artistische Einlage gibt es sogar auch, allerdings nicht von ihm selbst). Die Magd Nuri wird von Tatjana Charalgina gegeben. Sie steckt in einem Kartoffelsack ähnlichen Gewand und kann in ihrem einfachen Gemüt die schrecklichen Vorkommnisse nicht verarbeiten, was sich in zuckenden Bewegungen widerspiegelt und einem nachhaltigen Umklammern eines türkis-farbigen Nilpferdes. Der äußeren Erscheinung im Widerspruch begeistert sie mit ihrem lyrischen Sopran. Bestens besetzt sind auch die drei Schwätzerinnen Pepa (Susanne Geb), Antonia (Patricia Roach) und Rosalia (Katherine Marriott). Es sind Lebedamen, was sie auch mit ihrem äußeren Erscheinungsbild (Dirndls mit Schulterträgern und hochgesteckten roten Haaren) zur Schau tragen (Kostüme: Thomas Kaiser). Eine setzt sich denn auch mal fröhlich kopulierend auf einen Kerl, von wegen feine Dame…
Der Gemeindeälteste Tommaso (mit betörendem Baß: Kammersänger Hans-Otto Weiß; alternierend mit Kai Uwe Schöler) sitzt in der erwähnten Eisverkaufsmülltonne und schließt in stoischer Gelassenheit einen Umschlag nach dem anderen.
Viele Dinge passieren, so dass bei einem einzigen Operbesuch kaum alles erfasst werden kann, was sich da Katharina Wagner alles einfallen ließ und gleichzeitig sind ja auch noch die Musik und der Gesang zu genießen. Ein mehrmaliger Besuch ist daher sicher nicht verkehrt.
Manche Wunden bleiben ein Leben lang, da helfen auch kein Traum und kein Wunder. Selbst der Tod Sebastianos hilft in der Sicht Katharina Wagners der Marta nicht, von dem Widerling loszukommen, ihn zu überwinden oder gar zu vergessen. Von dem Alptraum, der sie ein Leben lang begleitet hat, kommt Marta einfach nicht los. Pedro will nach der gemeinsamen (!) Tötung Sebastianos fortziehen, doch sie umklammert den Leichnam Sebastianos, während effektvoll die heile Bergwelt (in Form des Pyramidenzelts) in Feuer aufgeht und für immer zerstört ist.
Zu Beginn der Oper steht ein Klarinettensolo. Bei der Frankfurter Tiefland Inszenierung im Jahr 2006 stellte der Bayreuth erfahrene Generalmusikdirektor Sebastian Weigle (der auch Gast der Mainzer Premiere war und im April in Frankfurt erstmals „Tristan und Isolde“ dirigieren wird) die Klarinette hierfür auf die Bühnenseite. Unter Catherine Rückwardts Dirigat ist das Klarinettensolo weit entrückt. Kaum hörbar kommt es von weit her. Mit dem Einsetzen des vollen Philharmonischen Staatsorchester Mainz steigt dann aber der Klangpegel, wobei Rückwardt vermeidet, die schwelgerische und zu Tränen rührende Musik mit zu viel Pathos anklingen zu lassen. Das Orchester spielt zurückhaltend und damit sehr sängerfreundlich.
Langer, tosender Applaus.
Markus Gründig, März 11
Daphne
Oper Frankfurt
Wiederaufnahme Saison 2010/11
Besuchte Vorstellung: 13. März 11
Die deutsche Bevölkerung kann sich glücklich schätzen, in einem Land zu leben, das dem Musik~Theater breiten Raum einräumt. Nach Angaben des Deutschen Bühnenvereins sind in jeder Spielzeit allein auf den Bühnen der Stadttheater, Staatstheater und Landesbühnen etwa 4.600 Inszenierungen zu sehen. Hinzu kommt das vielseitige Angebot der Privattheater, der freien Theatergruppen und Festivals. Zur Würdigung der vielseitigen Arbeiten gibt es seit dem Jahr 2006 den nationalen Theaterpreis „Der Faust“, eine Initiative des Deutschen Bühnenvereins, der Bundesländer, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Bei der letzten Preisvergabe im vergangenen November im Aalto-Theater Essen, wurde Claus Guth mit einem „Faust“ für seine Regie bei der Frankfurter „Daphne“ ausgezeichnet. Die Inszenierung hatte im März 2010 Premiere und wurde jetzt zum ersten Mal wiederaufgenommen.

Oper Frankfurt
Apollo (Arnold Rawls), Daphne (Juanita Lascarro), Leukippos (Carsten Süss)
© Wolfgang Runkel
Dabei gab es bei den Hauptrollen interessante Neubesetzungen. Als Leukippos gab Carsten Süss, ein gern gesehener Gast in Frankfurt, sein Rollendebüt. Er überzeugte mit klar fokussierter Stimme. Ebenfalls sein Rollendebüt gab der amerikanische Tenor Arnold Rawls, nachdem er an der Oper Frankfurt erst im Februar als San-Lui in „L´Oracolo“ und Roberto in „Le Villi“ sein deutschlandweites Operndebüt gegeben hat. Die große Partie des Apollo meisterte er gut, verlangt sie doch enorme vokale Ausbrüche bei gleichzeitig intensiven Klängen des Orchesters. Besonders intensiv gelang ihm seine finale Arie „Was erblicke ich? Himmlische Schönheit !“.
Aus dem Ensemble ist Alfred Reiter als sonorer Peneios neu in die Produktion eingestiegen. Tanja Ariane Baumgartner besticht, wie bereits bei der Premierenserie, als Mutter Gaea mit ihrem dunkel leuchtenden, warmen Mezzosopran. In den kleineren Partien sind sowohl premierenbewährte als auch neubesetzte Mitglieder des Ensembles und des Opernstudios vertreten.
Wichtigster Publikumsmagnet für diese Wiederaufnahme ist die beliebte Sopranistin Juanita Lascarro in der Titelrolle. Diese hat sie bereits vertretungshalber bei der ersten Aufführungsserie zweimal gegeben und auch schon unter Christian Thielemann an der Deutschen Oper Berlin, unter Ingo Metzmacher an der Nederlandse Oper Amsterdam und konzertant unter Edo de Waart am Concertgebouw Amsterdam. Für ihre berührende Darstellung der Daphne und für ihre hell leuchtende, einwandfrei geführte Stimme erhielt sie den meisten Applaus. Dicht gefolgt vom Frankfurter Opern- und Museumsorchester, das bei dieser Aufführungsserie von Hans Drewanz geleitet wird (Drewanz prägte ab 1963 als jüngster Generalmusikdirektor über drei Jahrzehnte das Opern- und Konzertleben Darmstadts und dirigiert heute regelmäßig an der Deutschen Oper am Rhein und der Bayerischen Staatsoper München).
Die Musik ist bei „Daphne“ weit mehr als nur Träger für die Stimmen. Richard Strauss hat in seinem Spätwerk raffinierte Melodien komponiert. Liebreizend und doch nicht überladen, dazu eine vielschichtige Instrumentalisierung, die die Orchesterklänge zu einer gleichgewichtigen Rolle erheben. Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester entfaltete einen filigranen, träumerischen Klang und ein glutvolles Spiel gleichermaßen. Bei dieser „Daphne“ gibt es viele poetische Momente auf der Bühne und aus dem Orchestergraben zu genießen. Letzte Möglichkeiten dazu bestehen noch am 20. und 26. März, sowie am 1. April 11.
Markus Gründig, März 11
Tamerlano
Oper Bonn
Besuchte Vorstellung: 27. Februar 11 (Premiere)
Barockopern haben schon etwas Eigenartiges, das gilt auch für Händels Oper „Tamerlano“. Die titelgebende Figur (Tartarenherrscher Tamerlano) und die die Figur des griechischen Prinzen Andronico sind als Hosenrolle angelegt (für eine Alt-Sängerin, bei der Uraufführung wurden beide Rollen von Kastraten gesungen). Das Stimmempfinden unterschied sich deutlich zu dem von heute. In einem wichtigen Gebiet brachte Händels „Tamerlano“ aber schon Neues. Bis dahin waren bei der Opera Seria Tenöre eher in Nebenrollen vertreten.
Mit der Besetzung des italienischen Francesco Borosini in der Rolle des gefangen genommenen Türkenherrschers Bayazit zur Uraufführung, änderte sich das. Er erhielt zum Ende der Oper einen groß angelegten Monolog, den Händel großartig zwischen Rezitativen und Ariosi angelegt hat. Ursprünglich vorgesehene Arien kurz davor und danach wurden just vor der Uraufführung gestrichen. Mit der ausführlichen Darlegung von Bayazits Seelenqualen, seines aufgewühlten Innenlebens, kann die Figur als Vorankündigung von Beethovens Florestan gesehen werden.

Oper Bonn
Bajazet (Mirko Roschkowski), Asteria (Emiliya Ivanova)
© Thilo Beu
Die Oper Bonn verpflichtete für dieses Dramma per musica (italienische Oper mit ernstem Inhalt) Philipp Himmelmann, der hier zuletzt in der vergangenen Saison Prokofjews „Die Liebe zu den drei Orangen“ inszenierte. Ort und Zeit der Handlung von „Tamerlano“ ist die Burg zu Bursa, die Hauptstadt Bithyniens, im Jahre 1402, theoretisch. Denn Himmelmann versetzte das Stück in einen abstrakten Raum, der geschickt mit optischen Täuschungen in Form von scheinbar aufeinander gestapelten Würfeln aufwartet, als Spiegelbild für die durcheinander geratene Gefühls- und Wahrnehmungswelt der Protagonisten.
In der Mitte befindet sich ein großes, ebenso bemustertes Portal, das sich in kleineren Einheiten aufgliedert, die gegeneinander gedreht werden. Auf der einen Portalseite gibt eine große dreidimensionale Zeichnung eine Palastinnenansicht wider. Im zweiten Teil, nach der Pause, ist diese kaum noch zu sehen, jetzt ist der Fokus allein auf die Protagonisten gerichtet (Bühne: Johannes Leiacker). Dabei konzentriert sich Regisseur Himmelmann ganz besonders auf die Figur der von gleich drei Männern geliebten Asteria, die hier mit wunderbarer Sopranstimme aufwartend von der gebürtigen Bulgarin Emiliya Ivanova innig verkörpert wird (und die ganze Zeit über auf der Bühne präsent ist). Die Ausleuchtung ist überwiegend kühl gehalten, womit die dunkle Stimmung dieses Dramas untermauert wird (lediglich die Irene erhält bei einer Szene einmal warmes Licht).
Das Stück wurde um einige Nummern und um die Figur des Leone gekürzt, die Spielzeit beträgt gute zwei Stunden (zuzüglich der Pause). Bei der Vielzahl an Secco-Rezitativen und Arien fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Anderes schon eher. Nachdem sich der Vorhang nach der Ouvertüre gehoben hat, steht bereits Asteria am Bühnenrand und fuchtelt mit einem großen Messer an ihrem Kopf herum. Das lässt nichts Gutes hoffen, singt parallel doch hinter einem Gazevorhang bereits ihr in Gefangenschaft geratener Vater Bajazet davon, sich umbringen zu wollen. Das Schlussbild gleicht später dann wieder dem Anfangsbild, nur mit dem Unterschied, dass Asteria nunmehr ernst macht. Die im Libretto vorgesehene plötzliche Wandlung Tamerlanos, gegenüber Asteria Gnade walten zu lassen, lässt sich angesichts ihrer schweren Taten nun einmal nicht plausibel darstellen (ebenso wenig Tamerlans plötzliche Hinwendung zu Irene).
Barocke Pracht lässt sich allenfalls in den Kostümen von Katherina Kopp erahnen, die gleichzeitig sehr moderne Züge aufweisen (so etwa das schwarze eng anliegende Kleid der Irene, mit hohen Stiefeln fast ein wenig bizarr wirkend). Musikalisch glänzte das verkleinerte Beethoven Orchester Bonn unter der Leitung von Rubén Dubrovsky (der hier im Jahr 2008 mit Vivaldis „Orlando Furioso“ als Dirigent debütierte) mit einem farbenreichen und packenden Zugriff auf Händels emotionale Musik. Dank einer Continuogruppe (Orgel und Cembalo: Christopher Sprenger; Violoncello: Grigory Alumyan; Laute: Stanislaw Gojny; Kontrabass: Ingo Klatt) ertönte ein frischer, barock anmutender Klang.
Für die Sänger gab es bei der Premiere ob des ariosen Glanzes zahlreiche Zwischenapplause. Dies betraf nicht nur die bereits erwähnte Ivanova, sondern auch die Gäste (Countertenor Antonio Giovannini mit bezauberndem Timbre in der Rolle des Andronico und Mariselle Martinez als disziplinierter Tamerlano), wie auch für die Ensemblemitglieder (Mirko Roschkowski mit kraftvoller Tenorstimme als Bajazet und Susanne Blattert als aufmerksame Irene). Der eindringliche Blick des Regieteams auf die Figuren, die intensive darstellerische Präsenz und am meisten die vorzügliche musikalische Umsetzung wurde vom Publikum am Ende einhellig bejubelt.
Markus Gründig, Feb. 11
La Wally
Oper Frankfurt
Konzertante Aufführung in Kooperation mit der Alten Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 6. Februar 11 (Premiere)
Die Oper „La Wally“ entstand nach dem bekannten Heimatroman: „Die Geierwally“, von Wilhelmine von Hillern. Im Gegensatz zur Romanvorlage gibt es in der Opernfassung (Libretto: Luigi Illica) jedoch kein sentimentales Happy End. Was auch auf das Leben des Komponisten Alfredo Catalani zutrifft. Er starb bereits 39jährig, achtzehn Monate nach der bejubelten Uraufführung (die 1892 in der Mailänder Scala erfolgte).
Der Italiener Catalani stand zwischen zwei Musikepochen. Die Zeit Verdis hatte ihren Höhepunkt überschritten, der Verismus war erst am Aufkommen. Wobei er sich von diesem auch bewusst abgrenzen wollte. In seinen Werken verzichtet er auf weit gespannte und einprägsame Kantilenen, auf Melodien mit schlaghafter Wirksamkeit. Auch bei seiner Themenwahl grenzte er sich vom Verismus ab. Obwohl „La Wally“ im Jahr 1800 in Tirol spielt, verzichtete Catalani weitestgehend auf ein folkloristisches Kolorit. Beispielsweise imitieren bei Walters Lied vom Edelweiß die Fiorituren einen Jodler. Differenzierte, vielschichtige Harmonik, bei farbiger und fantasievoller Instrumentation, führte bei ihm zu atmosphärischen Orchesterpassagen, die natürliche und übernatürliche Phänomene fast plastisch wiedergeben. Am deutlichsten wird dies beim starken Sturm am Ende der Oper. Hier fegt einen quasi der musikalische Wind aus den Sitzen.

Oper Frankfurt / Alte Oper Frankfurt
Morenike Fadayomi (Wally) sowie den Chor der Oper Frankfurt und das Frankfurter Opern- und Museumsorchester
© Wolfgang Runkel
Am Pult des Frankfurter Opern und Museumsorchesters stand ein guter Bekannter der Oper Frankfurt, der italienische Maestro Carlo Franci (er dirigierte ohne Partitur, in Italien hat diese Oper einen anderen Stellenwert im gängigen Opernrepertoire). Orchestrale Höhepunkte waren die differenziert und sensibel gespielten symphonischen Vorspiele zum 3. (die Unruhe Wallys zeichnend) und zum 4. Akt (Wallys Einsamkeit zeichnend). Franci interpretierte „La Wally“ mit großem Verve und sorgte für viele aufbrausende Momente. Da hatte es der von Matthias Köhler einstudierte und hinter dem Orchester platzierte Chor mitunter schwer, gegen die Klangmasse der vielen Instrumente anzukommen. Weniger bzw. keine Probleme hatten damit die formidablen Solisten. Rollenbedingt leider nur im ersten Akt zu erleben war der Bass Enrico Iori. Wotanmäßig trumpfte er mit seiner überaus kraftvollen Stimme auf und gab einen ungemein jungen und sympathischen siebzigjährigen Vater ab. Es war nicht nur sein Debüt für eine Produktion der Oper Frankfurt, sondern auch ein Rollendebüt.
Als Vinzenz Gellner aus Hochstoff war kurzfristig Piero Terranova für den erkrankten Mikael Babajanyan eingesprungen. Obwohl die Rolle des Gellner eine zentrale Figur in dieser Dreiecksgeschichte ist und Terranova stimmlich tadellos sang, blieb er im Gesamtbild doch hinter seinem großen Widersacher zurück. Diesen gab Frank van Aken, der zuletzt als Siegmund in „Die Walküre“ bestach. Auch als Jäger Giuseppe Hagenbach aus Sölden begeistert er mit seiner starken und tiefen Tenorstimme, so dass gerade auch die finstere Seite der Figur betont wurde (schließlich ist die Figur keine klassische Tenorrolle, hat Hagenbach auch eine aggressive und dunkle Seite). Als Bote von Schnals gefiel Ensemblemitglied Vuyani Mlinde. Gefallen haben auch die beiden Sängerinnen der kleineren Damenrollen: Tanja Ariane Baumgartner als Wirtin Afra und Anna Ryberg in der Hosenrolle des Zitherspielers Walter.

Oper Frankfurt / Alte Oper Frankfurt
v.l.n.r.: Matthias Köhler (Chordirektor der Oper Frankfurt), Enrico Iori (Stromminger), Vuyani Mlinde (Der Bote von Schnals), Piero Terranova (Vincenzo Gellner), Morenike Fadayomi (Wally), Carlo Franci (Musikalischer Leiter), Anna Ryberg (Walter), Frank van Aken (Giuseppe Hagenbach), Tanja Ariane Baumgartner (Afra) sowie den Chor der Oper Frankfurt und das Frankfurter Opern- und Museumsorchester
© Wolfgang Runkel
Allesamt solide und tolle Sänger und doch nichts im Vergleich zur fantastischen Morenike Fadayomi in der Titelrolle. Sie übernahm für die erkrankte Catherine Foster die Partie der Wally. An der Oper Frankfurt war sie bereits im Jahr 1998 in der Rolle der Hanna Glawari („Die lustige Witwe“ von Franz Lehár) zu erleben. Seit der Saison 1997/98 ist sie Ensemblemitglied der Deutschen Oper am Rhein (Düsseldorf/Duisburg). Dort hat sie die Rolle der Wally bereits 2005 szenisch gestaltet und wird dies auch bei der Wiederaufnahme im Juni 2011 tun. Und es macht dann schon einen Unterschied, ob vom Blatt gesungen wird oder nicht. Denn sie verzichtete bei der konzertanten Aufführung in der Alten Oper als Einzige auf Noten und sang umso freier, ausdrucksstärker und berührender.
Die Figur der Wally erweckte sie zum Leben: glühend vor Leidenschaft, stolz, willensstark, verletzlich und voller Empathie. Ihre große Arie „Ebben … Ne andrò lontano“ ist nicht nur der Smashhit aus „La Wally“, sondern generell der größte Erfolg von Alfredo Catalani. Im Repertoire vieler Sängerinnen, von der Callas bis zur Brightman, wurde er vor allem durch Jean-Jacques Beneix‘ Film „Diva“ einem größerem Publikum bekannt. Wally, vom Vater verstoßen (weil sie nicht den ihr bestimmten Mann heiraten will), flieht in die Berge: „Ebben … Ne andrò lontano“, was so viel heißt wie „Nun gut, ich werde fortgehn´“. In sphärischen, zarten Tönen beginnend, steigert sich die Arie zur größten Dramatik. Fadayomi bestach jedoch nicht nur bei dieser Arie, sondern durchweg in allen vier Akten, mit ihrer wunderbar geführten Stimme. Langanhaltender und tosender Applaus, allen voran für den Star des Abends: Morenike Fadayomi.
Markus Gründig, Feb. 11
Tosca
Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 21. Januar 11 (mit anschließenden Gespräch “Oper lieben”, mit Elke Heidenreich, Erika Sunnegardh, Jason Howard, Jan Seghers und Malte Krasting)
Ein Zauber wie bei kaum einer anderen Oper geht von Giacomo Puccinis „Tosca“ aus. Gilt sie vielen doch als Inbegriff des Genres schlechthin. Sie bietet eine dramatische, packende Liebesgeschichte, Musik, die ins Herz geht (nebst herzzerreißende Arien). Nicht zuletzt verbindet man auch viele Sängerpersönlichkeiten, wie die unvergleichliche Callas in der Titelrolle, mit dieser Oper. So sind die Erwartungen bei einer Neuproduktion natürlich sehr hoch.
Mit zwei der angesagtesten Koryphäen des Musiktheaterbetriebes wartet daher die Frankfurter Neuinszenierung von „Tosca“ auf. Da ist zum einen der gebürtige russische Dirigent Kirill Petrenko (aus dem weit entfernten Omsk stammend), der an der Oper Frankfurt vor fünf Jahren mit Mussorgskijs „Chowanschtschina“ debütierte und in den vergangenen beiden Jahren bei Pfitzners „Palestrina“ das Frankfurter Opern- und Museumsorchester leitete. Zur Saison 2013/14 wird er die Position des Generalmusikdirektors an der Bayerischen Staatsoper in München antreten. Zuvor übernimmt er u.a. noch im kommenden Jahr das Dirigat für die Neuinszenierung von Wagners „Ring“ in Bayreuth.
Und da ist zum anderen der Regisseur der neuen Frankfurter „Tosca“: Andreas Kriegenburg. Der mehrfach ausgezeichnete Theaterregisseur liefert mit dieser „Tosca“ seine inzwischen fünfte Operninszenierung und wird im nächsten Jahr an der Bayerischen Staatsoper in München den kompletten „Ring“ inszenieren. Im vergangenen März stellte er sich erstmals in Frankfurt vor (mit Goldonis „Der Diener zweier Herren“ für das Schauspiel Frankfurt im Bockenheimer Depot). Seit der Saison 2009/2010 ist er Hausregisseur des Deutschen Theaters Berlin und jetzt gar zeitgleich mit zwei Produktionen an den Städtischen Bühnen Frankfurt vertreten. Denn neben der „Tosca“ setzte er sich im Schauspiel Frankfurt mit Goethes „Stella“ auseinander (die Premiere war genau eine Woche nach der Premiere von „Tosca“).
Petrenko und Kriegenburg bilden daher eine hervorragende Ausgangsbasis und ein perfektes Duo. Die hohen Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen, wenn auch ganz anders als man sich dies vielleicht vorher ausgemalt hat. Petrenko, der hier erstmals „Tosca“ dirigiert, hatte sich dieses Dirigat ausdrücklich gewünscht. Und seine Hingabe und intensive Auseinandersetzung mit der Musik ist besonders deutlich zu hören. Dabei, wie Malte Krasting bei „Oper lieben“ im Anschluss an die besuchte Vorstellung noch einmal hinwies, verzichtet Petreko auf den üblichen breiten Klangwulst Puccinis, der in dieser Form auch gar nicht in der Partitur stehe. So erklingen natürlich die bekannten lieblichen Melodien, aber eben auch viel Unbekanntes, quasi ein Puccini reloaded. Immerhin ist Puccini ein Musiker des 20. Jahrhunderts (die Uraufführung von „Tosca“ fand am 14. Januar 1900 statt).
Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester glänzt bei der Umsetzung der feinfühlig aufgefächerten Zwischentöne mit vornehmer Zurückhaltung und Akkuratesse. Natürlich schmettert es auch kräftig aus dem Orchestergraben, schließlich hat die Musik bei dieser Oper die Aufgabe des Stimmungsmachers, des Krimischreibers. Wenn auch als Opernkrimi beschrieben, ist diese Oper für einen richtigen Krimiautor wie Jan Seghers eher ein Schurkenkrimi. Denn der Antagonist stirbt ja schon im 2. Akt und es gibt keinen Spannungsbogen, der vom Anfang bis zum Ende reicht. Das die Oper dennoch funktioniert liegt für Seghers eindeutig an der Musik.
Den außergewöhnlichen orchestralen Klangfarben fügen sich die Sänger auf hohem Niveau ein. Erika Sunnegårdh ist eine vor Liebe glühende Flora Tosca. Mit berührenden Tönen und ausdrucksstark bei „Vissi d’arte“ (Für die Kunst habe ich gelebt) sorgt sie für große Anteilnahme im Publikum und für erhält dafür auch einen Szenenapplaus. Aleksandrs Antonenko hat als Mario Cavaradossi die Gunst, die bekannteste Arie der Oper singen zu können: „E lucevan le stelle“ (Es leuchteten die Sterne). Das tut er mit starker Inbrunst, ohne stark zu forcieren.
Der Scarpia des Jason Howard ist mehr als moderner Geschäftsmann, denn als finsterer römischer Polizeichef angelegt. Er zeigt, wie Macht korrupt macht und gefällt dabei mit seinem baritonalen Timbre. Auf hohem Niveau sind auch die kleineren Rollen besetzt, mit Franz Mayer als Mesner, Vuyani Mlinde als geflohener Häftling Cesare Angelotti und Michael McCown als Spoletta. Groß ist das Choraufgebot mit Extra- und Kinderchor (Einstudierungen: Matthias Köhler, Michael Clark), die in den klerikalen Kostümen von Tanja Hofmann schon optisch einen formidablen Eindruck hinterlassen. Es gibt bei dieser Oper zwar nur wenige Chorstellen, doch bei den wenigen überzeugen die Chöre mit ihrer Präsenz und oratorienhaften Stärke. Lobend zu erwähnen ist auch Frederik Callies (Solist der Aurelius Sängerknaben Calw) als Hirte.
Tosca kann als opulente Ausstattungsoper inszeniert werden, zur Zeit der chilenischen Diktatur (wie 2006 am Staatstheater Darmstadt) spielen, oder ganz im Hier und Heute. Für Letzteres entschied sich Andreas Kriegenburg, der in einem Interview einmal sagte, dass Oper stets von heute sein müsse, da sie von heutigen Menschen gemacht wird. Gleichwohl braucht man nicht zu fürchten, diese „Tosca“ spiele in einem Supermarkt oder irgendwo in der digitalen Medienwelt. Zusammen mit Bühnenbildner Harald Thor entstand ein schlichter, mehrfunktionaler und modern wirkender Einheitsraum aus hellem Furnierholz.
Zunächst nur als große Wand nah am Bühnenrand, mit ausgelassenem Kreuz aus farbigen Mosaiksteinen, kippt diese Wand später um und gibt den Blick ins Innere der karg ausgestatteten Kirche Sant Andrea della Valle frei. Dieser Raum kann aber auch verengt werden und bildet dann Scarpias Zimmer im oberen Stockwerk des Palazzo Farnese. Zunächst großzügig elegant mit gläsernen Fronten, verengt er sich kammerspielartig und dient im finalen dritten Akt als Plattform der Engelsburg (mit nur einem Spalt zum Himmel, an dem keine Sterne glänzen). Man fragt sich, wo wird denn Flora Tosca eine Mauerbrüstung finden, um in den Tod springen zu können oder wird sie den Suizid vielleicht mit einem Dolch ausführen?
Die gefundene Lösung ist brillant: schlicht und visuell äußerst effektvoll (mehr sei hier nicht verraten). Wie auch das Bild der Maria Magdalena/ Marchese Attavanti hier genial erscheint. In Form von Olga Tobreluts Bild „La Madone“ (Kate Moss) im XXL-Format: Sinnlich und mysteriös in den Bann ziehend. Kriegenburgs Personenführung ist sehr sorgfältig ausgearbeitet, Er lässt die Protagonisten gerne publikumsfreundlich nah zum Bühnenrand agieren, wie die Figuren trotz der schlichten wie grandiosen Optiken stets im Mittelpunkt stehen.
Die neue „Tosca“ ist eine auf allen Ebenen herausragende und spannende Produktion, die wohl viele Jahre für volle Vorstellungen sorgen wird (daher rechtzeitig Karten sichern).
Markus Gründig, Januar 11
König Roger
Staatstheater Mainz
Besuchte Vorstellung: 15. Januar 11 (Premiere)
Nach Musiktheaterklassikern wie „Tannhäuser“ und „My Fair Lady“ gibt es am Staatstheater Mainz als erste Opernproduktion im neuen Jahr ein eher unbekanntes Werk zu sehen: Karol Szymanowskis dreiaktige Oper „König Roger“. Von seinem Alter her passt Szymanowskis zu den Künstlern, die derzeit in Frankfurt angesagt sind: Zemlinsky, Schönberg, Mahler (bei der Musiktheater-Performance „Neunzehnhundert“) und Schnitzler (beim Schauspiel „Liebelei“). Doch der polnische Musiker Szymanowskis hat nicht so einen starken Bezug zu Wien wie diese. Ihn zog es stark nach Italien, hier hatte es ihm insbesondere Sizilien angetan.
Das Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen und Religionen aus dem Osten und dem Westen regten ihn zu seiner einzigen Oper an. Auch wenn seine weiteren vier Bühnenwerke unbekannter sind, mit seinen Klavierzyklen, Konzerten, Sinfonien und Sonaten und eben der Oper „König Roger“ ist er zur wichtigsten polnischen Komponistenpersönlichkeit zwischen Chopin und der polnischen Moderne geworden. Nahezu alle Strömungen der europäischen Musik um die vorletzte Jahrhundertwende (wie Impressionismus, Expressionismus, Folklorismen, Orientalismen, Dur/Moll-Tonalität und chromatische Schichtungen), finden sich in seinen Werken. Dennoch hat er stets seine eigene musikalische Sprache gefunden.

Staatstheater Mainz
Der Hirte (Ryszard Minkiewicz), König Roger (Heikki Kilpeläinen)
Foto: Martina Pipprich ~ martina-pipprich.de
“König Roger“ zählt zudem zu den wenigen Werken, die zwischen den beiden Weltkriegen zur Uraufführung gelangten. Zwar als Oper bezeichnet, ist das Stück aber auch Oratorium und Mysterienspiel (darin auch Werken wie Schönbergs „Moses und Aaron“ ähnlich). Die Geschichte eines mysteriösen Hirten, der das Privatleben und Reich eines Königs durcheinanderbringt lässt viele Fragen offen.
Nicht oft gespielt gab es im Jahr 2009 gar drei Neuinszenierungen (in Paris, Bonn und Bregenz).
Christentum, Hellenismus und pantheistische Mythen treffen bei „König Roger“ aufeinander und das war für das Inszenierungsteam wohl Hauptausgangspunkt. Denn die Bühne von Alfons Flores besteht aus gut 40 Skulpturen von Gottheiten, Märtyrer und Heiligen (sie stammen aus dem Fundus verschiedener Theaterhäuser, die diese dem Staatstheater Mainz zur Verfügung gestellt haben). Sie geben den szenischen Rahmen, fahren vom Schnürboden herab und herauf, aber nie so hoch, dass man sie nicht mehr sehen könnte.
Die Ausleuchtung ist überwiegend dunkel gehalten und so konzentriert sich alles auf die Sänger und die Musik. Imposant ist schon der Beginn, wenn das Volk bei vollkommener Stille aus dem Hintergrund mit langsamen Schritten nach vorne läuft, ein archaisches Bild, passend zum 12. Jahrhundert, der Zeit, in der das Stück spielt. Regisseur Joan Anton Rechi vermeidet plakative Effekte. König Roger legt sich zwar in die Badewanne, aber nicht nackt. Und selbst die große Orgienszene gerät nicht zum Fanal. Die Oper wird ohne Pause in kurzweiligen neunzig Minuten gespielt. Dabei begeistern die drei Hauptrollen, der Chor und das Philharmonische Staatsorchester Mainz gleichermaßen.
Susanne Geb, zu Beginn von Intendant Matthias Fontheim als etwas indisponiert angekündigt, gibt eine starke Roxane. Anfangs unglücklich in der Ehe, lebt sie mit Erscheinen des Hirten auf. Mit Klängen, die wie aus einer anderen Welt kommend erscheinen, verzaubert sie mit ihrer wandlungsfähigen Stimme im piano wie bei ihren expressiven Ausbrüchen. Als grübelnder und schlussendlich geläuterter König Roger besticht der Bassbariton Heikki Kilpeläinen mit seiner kraftvollen und hervorragend geführten Stimme.
Der Hirte des Ryszard Minkiewicz ist vielleicht nicht ganz so jugendlich wie erhofft, doch dafür sängerisch und schauspielerisch eine Extraklasse und das ist ja, was zählt. Er ist ein Szymanowski-Spezialist und hat schon bei vielen Produktionen von „König Roger“, wie auch bei Aufnahmen, mitgewirkt. Zudem ist er Professor an der Universität von Gdańsk und der Musikakademie von Gdańsk. Sein Hirte ist agil, leicht und charismatisch. Ihm erliegen alle, selbst König Roger entdeckt auf einmal neue Seiten an sich, als der Hirte auf ihm liegt…
Die schönen Stimmen werden von einem großen Choraufgebot unterstützt. Neben dem von Sebastian Hernandez-Laverny einstudierten Chor ist zusätzlich der Knabenchor des Mainzer Doms beteiligt (Einstudierung: Mathias Breitschaft). Was den Abend aber zu einem herausragenden Erlebnis macht, ist das Philharmonische Staatsorchester unter dem Dirigat des jungen Kappellmeisters Andreas Hotz. Erstaunlich, was für vielfältige Tonvariationen mit Klängen aus Orient und Okzident Szymanowskis Oper bietet und hier mit viel Feingefühl zu einem Ohrenschmaus ertönen. Kein Wunder, dass das Publikum stürmisch applaudierte.
Markus Gründig, Januar 11
Neunzehnhundert – Ein ewiges Lied
Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot
Besuchte Vorstellung: 12. Januar 11
Musik-Theater Performance aus der Zeit des Fin de siècle
Wie jeder Jahrhundertwechsel, stellte auch der Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert eine besondere Zeit dar. Dabei fanden gerade bei diesem fundamentale Entwicklungen auf fast allen Gebieten statt, sei es in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft oder in der Kultur. Viele Größen aus Literatur, Musik und Philosophie kamen zu dieser Zeit aus Wien bzw. hatten einen direkten Bezug dazu: Musil, Broch, Hofmannsthal, Schnitzler, Altenberg, Kraus, Freud, Wittgenstein, Mach, Loos, Mahler, Schönberg, Klimt, Zemlinsky, um nur einige zu nennen.
Drei dieser Künstler wurden mit je einem Werk nun für ein Musiktheaterprojekt der besonderen Art ausgewählt: Zemlinsky, Schönberg und Mahler. Dabei handelt es sich bei keinem der ausgewählten Stücke um eine Oper. Zu erleben gibt es eine bildhaft begleitete musikalische Darbietung, bei der auch gesungen wird. Alle drei Stücke stammen aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Sie weisen zwar schon auf die neue Zeit hin, stehen musikalisch aber eher der neuromantischen Moderne nahe.
Das Regieteam um Elisabeth Stöppler (Regie) und Hermann Feuchter (Bühne) hat dafür auf imposanter Weise Wiener Atmosphäre in das Bockenheimer Depot gezaubert. Reste eines gestürzten Riesenrades, mit im Raum verteilten, teilweise auf dem Kopf stehenden Kabinen verdeutlichen, dass auch zur guten alten Zeit nicht alles so perfekt war, wie gemeinhin angenommen. Bunte Lichterketten konterkarieren die angespannte Stimmung zur Zeit des Fin de siècle.
In historisch anmutender Kleidung (Kostüme: Frank Lichtenberg) reagieren elf Schauspieler und zwei Sänger auf die Musik, ohne wirklich eine Geschichte zu erzählen. Vermittelt werden Gefühle und Stimmungen, die Musik wird in fließenden Bildern umgesetzt. Dabei stellen die Darsteller einen Querschnitt der Wiener Bevölkerung dar: vom leichten Mädchen bis zur Grande Dame, vom Arbeiter bis zum Geschäftsmann. Schon lange vor dem eigentlichen Beginn befinden sie sich auf der offenen Bühne, die nahtlos ins Foyer übergeht. Hier taumeln sie noch ganz benommen vom Unfall des gestürzten Riesenrades aus den Kabinen und versuchen Halt und Orientierung zu finden (Choreografie: Dorothea Ratzel). Mit Auftreten des Dirigenten Yuval Zorn (seit 2008 Kapellmeister an der Oper Frankfurt) beginnt der musikalische Teil dann nahezu übergangslos.

Oper Frankfurt im Bockenheiemr Depot
Der Alt (Tanja Ariane Baumgartner; oben sitzend), der Tenor (Shawn Mathey; in der Gondel) und Ensemble
Foto: Barbara Aumüller ~ szenenfoto.de
Zu Beginn dieses Programms steht ein Klavierstück von Alexander Zemlinsky, der dem Frankfurter Opernpublikum aus 2007 von „Die florentinische Tragödie“ und „Der Zwerg“ bekannt ist. Er war ein Bewunderer Johannes Brahms’ und Richard Wagners. Erst später folgte er Mahler in dessen Abgründigkeit, auch wenn in seinem Spätwerk wiederum Einflüsse von Kurt Weill und Paul Hindemith zu erkennen sind. Zemlinsky war auch ein erfolgreicher Lehrer, u.a. von Alma Mahler, seinem Schwager Arnold Schönberg und von E.W. Korngold.
Sein Werk „Ein Lichtstrahl“ – Musik zu einer Pantomime“, komponierte Zemlinsky für das Berliner Kabarett „Überbrettl“, wo es aber nie aufgeführt wurde (die Uraufführung fand erst 1992 in Wien statt). Das Klavierstück chargiert zwischen E- und U-Musik. Klavierkompositionen bei Zemlinsky, gemessen an seinem umfangreichen Gesamtwerk, nehmen eher einen bescheidenen Platz ein. Dennoch hat „Ein Lichtstrahl“ einen paradigmatischen Rang, da es umfangreich seine stilistische Entwicklung widerspiegelt. Hier wird es ob des starken Bühnengeschehens und dem massiven Vortragen diverser Tempi- und Regievorgaben jedoch etwas in den Hintergrund gerückt.
Arnold Schönbergs „Verklärte Nacht“ war zur Zeit seiner Uraufführung (mit Druck durchgesetzt 1902 im kleinen Musikvereinsaal Wien) ein Skandal, Schönbergs erster Skandal. Dies lag weniger an der modernen Musik, als am Thema. Schönberg vertonte hier ein Gedicht des von ihm geschätzten Richard Dehmel, dessen Texte meist um Liebe und Sexualität handeln. Schönberg komponierte das Stück 24-jährig bereits im Jahr 1899 (nur innerhalb einer Woche), damals weilte er im südlich von Wien gelegenen Payerbach, zusammen mit Zemlinsky, in dessen jüngere Schwester er sich verliebte.
Thematisiert wird die Geschichte einer jungen Frau, deren neuer Liebhaber das noch ungeborene, uneheliche Kind der Frau vorbehaltlos akzeptiert („Das Kind, das du empfangen hast, sei deiner Seele keine Last“), was zur damaligen Zeit undenkbar war.
Zunächst als Streichsextett geschrieben, erweiterte Schönberg es später auch um zwei Fassungen für Streichorchester (1917 und 1943). Das der Tristan-Harmonik verpflichtete Stück verzichtet auf vordergründig illustrierende Elemente und die Darsteller setzten die variantenreiche musikalische Form stimmig um, stets auch ein wenig Wiener Schmäh darstellend.
Zentrales und längstes Stück des Abends ist Gustavs Mahlers Spätwerk „Das Lied von der Erde“. Nach der hymnischen 8. Sinfonie (Sinfonie der Tausend) hätte es eigentlich als 9. Sinfonie betitelt werden müssen. Doch Mahler wollte dem Schicksal keinen Vorschub leisten, die unvollendet gebliebenen 9. Sinfonien bzw. ausgebliebenen 10. Sinfonien von Beethoven, Bruckner, Dvorac, Schubert haben die 9. Sinfonien zum Symbol des Abschieds gemacht. So gab er dem Werk den ungewöhnlichen Titel. Wobei die Bezeichnung Sinfonie auch nicht wirklich trifft, liegt es doch irgendwo zwischen sich zur sinfonischen hin verdichtenden Liedfolge und groß angelegter Sinfonie mit obligaten Singstimmen. Zudem hatte Mahler seine ganz eigene Art von Sinfonischer Dimension (als allumfassende Welterfahrung in Tönen).
Drei schicksalhafte Probleme ereilten Mahler vor der Komposition: Die Aufgabe als Künstlerischer Direktor der Wiener Hofoper, der Tod seiner ältesten Tochter Maria Anna und die Diagnose eines schweren doppelseitigen Herzklappenfehlers. Genug Gründe, für eine schwermütige Stimmung. Hans Bethges Nachdichtungen chinesisch meditativer Naturlyrik, Sieben Gedichte aus der Sammlung „ Die chinesische Flöte“, dienten Mahler als Basis um das allgemeingütige Thema von der allgegenwärtigen Präsenz von Leben und Tod. Die Uraufführung unter Bruno Walter erlebte Mahler nicht mehr mit, sie fand ein halbes Jahr nach seinem Tod statt.
Der gebürtige Offenbacher Künstler Jens Joneleit hat das ursprünglich für großes Orchester geschriebene Werk jetzt als Auftragsarbeit für die Oper Frankfurt in eine Fassung für kleines Orchester umgeschrieben. Unter der feinfühligen Leitung des leidenschaftlich agierenden Yuval Zorn erklingt Mahlers „Lied von der Erde“ nicht so düster, drückend und schwermütig. Das liegt aber auch an den großartigen Solisten Tanja Adiane Baumgartner (Der Alt) und Shawn Mathey (Der Tenor), die charismatisch und bei starkem Körpereinsatz raumgreifend gefordert sind und dabei mit warmer wie kräftiger Stimme das Publikum in ihren Bann ziehen.
„1900 – Ein ewiges Lied“ ist ein ungewöhnliches Projekt, das aufwendig und interessant umgesetzt wurde.
Markus Gründig, Januar 11
Dido and Aeneas / Herzog Blaubarts Burg
Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 10. Dezember 10 (mit anschließenden Gespräch “Oper lieben”, mit Elke Heidenreich, Constantinos Carydis, Sylvia Momsen und Paula Murrihy)
229 Jahre liegen zwischen den beiden Stücken, die beim neuen Doppelabend der Oper Frankfurt gezeigt werden. In der Musiktheatergeschichte ist dies ein immenser Zeitraum. Purcells „Dido und Aeneas“ wurde 1689 uraufgeführt. Zu dieser Zeit gab es noch nicht den großen Orchesterapparat des 19. und 20. Jahrhunderts. So zeichnet diese Oper dann auch ein kammermusikalischer Stil aus. Der 1918 uraufgeführte Bartók-Einakter „Herzog Blaubarts Burg“ hingegen nutzt gerade das große Orchester, um Gefühle und Stimmungen überaus plastisch zu zeichnen.
Und dennoch gibt es auch musikalisch eine Verbindung zwischen den beiden Stücken. Wie der junge griechische Dirigent Constantinos Carydis bei dem an die besuchte Vorstellung folgendem Gespräch „Oper lieben“ auf die Frage von Frau Elke Heidenreich antwortete, endet „Dido und Aeneas“ in Fis-Moll (wobei in Frankfurter diese Oper aufgrund der verwendeten historischen Instrumente einen Halbton tiefer gespielt wird) und „Herzog Blaubarts Burg“ beginnt in Fis-Moll. Doch dieser marginale Zusammenhang ist nicht entscheidend. Viel mehr, dass es in beiden Stücken um das Scheitern von Beziehungen geht, der Unmöglichkeit, Liebe leben zu können.
Barrie Kosky, designierter Intendant der Komischen Oper Berlin und damit Nachfolger des nach Zürich wechselnden Andreas Homoki, verbindet diese beiden Stücke bei kargen Bühnenbildern (Katrin Lea Tag) mit einer fesselnden Umsetzung, die Hand in Hand mit der bravourösen sängerischen Interpretation eines starken Sängerteams und einer ebensolchen musikalischen Interpretation des unter Constantinos Caryd feinfühlig und vehement aufspielenden Frankfurter Opern- und Museumsorchesters geht.
Elke Heidenreich, selten auf den Mund gefallene Kabarettistin, Literaturkritikerin, Moderatorin und Schriftstellerin, zeigte sich nach der Aufführung dann ganz ergriffen von diesem Opernerlebnis, bei dem ihr „Dido und Aeneas“ ein Gefühl von „Entschleunigung“ vermittelt und ihr gar die Sprache verschlagen habe. Zu Beginn ist der Eiserne Vorhang herabgelassen, sodass von Bühne und Orchestergraben nichts zu sehen ist. Mit einem regelmäßigen Knackgeräusch fährt er hoch, so als würde die Zeit zurückgedreht.
Alle Darsteller sind sodann bereits auf der Bühne präsent, die vor einer Faltwand lediglich eine große weiße Bank zeigt. Vom Karthago der antiken Zeit (mit Palast, Höhle und Schiffen) ist nichts zu sehen. Aber Dank der nahezu durchchoreografierten Personenführung entsteht auch ohne äußere Hilfsmittel ein dichtes Erlebnis. Die historisierenden Kostüme von Katrin Lea Tag vermitteln Pracht und Eleganz, Heiterkeit und Bedrohung (wie bei den Hexen). Gleichwohl wirkt gerade die Dido der Paula Murihy mit ihren Locken modern wie die Trendsetterin Carrie Bradshaw (aus „Sex and the City“).
Faszinierend auch die langhaarigen Vertreter des Bösen, die drei Countertenöre Martin Wölfel (Zauberin), Dmitry Egorov (1. Hexe) und Roland Schneider (2. Hexe).
Ähnlich Haydens Sinfonie Nr. 45 („Abschiedssinfonie“), verlassen zum Ende hin nacheinander Musiker und Sänger die Szenerie. Zurück bleibt einzig Dido, die nicht verzweifelt, eher sich dem Schicksal hingibt. Mit innerer Größe, würdevoll und mit Schnappatmung singt sie ihr Sterbenslamento „When I am laid in earth“ mit Gänsehautfaktor. Wenn auch mit kleinerem Rollenanteil, gefällt der Aeneas des Sebastian Geyer, die Belinda der Britta Stallmeister und die Second Woman der Anna Ryberg.
Auch nach der Pause ist der Eiserne Vorhang herabgelassen, doch fährt er jetzt geräuschlos nach oben. Frei wird der Blick auf einen leeren, schwarzen Raum. In Herzog Blaubarts Burg ist es finster, es gibt keine Fenster, kein Licht, keinen Sonnenschein. Die Drehscheibe zieht, leicht gekippt, langsam ihre Kreise. Nicht eine der sieben mysteriösen Türen ist zu sehen und doch entstehen plastische Bilder. Mit Hilfe dreier Statisten werden Folter-, Waffen- und Schatzkammer, verborgener Garten, Luft, und ein Tränensee effektvoll sichtbar, wenn aus den Jacketts Gold und Wasser rieselt und Rankpflanzen herauswachsen.
Claudia Mahnke ist die Judith, die sich mit Ihrer unnachgiebigen Neugier in den Tod stürzt.
Robert Hayward ist als Blaubart nicht nur sängerisch gefordert. Hier ist nicht ein rüder Frauenmörder, sondern ein besonders tief empfindender Mensch, dem jede Türöffnung einen tiefen Schmerz zufügt, sodass er von Krämpfen geplagt erschüttert wird und sich gegen das drohende Unheil wehrt. Aber aufhalten kann er es nicht und so endet auch dieses Stück Musiktheater mit dem Tod. Denn eine klassische Oper ist es nicht. Carydis „wir brauchen für dieses Werk keine Schublade“.
Wo bei Purcell die barocke Betörung durch viele allegorische Figuren in den Mittelpunkt gerückt wurde, ist es bei Bartók die organische Verbindung folkloristischen Kolorits mit artifiziellen Tönen. Zwei sehr unterschiedliche Werke, die vom Publikum begeistert aufgenommen wurden. Starker Jubel.
Markus Gründig, Dezember 10
Irrelohe
Oper Bonn
Besuchte Vorstellung: 7. November 10 (Premiere)
“Aus dumpfer Sucht – zu lichter Glut!“ (Richard Dehnel)
Dem zufälligen Halt eines Zuges in der bayrischen Ortschaft Irrenlohe (bei Schwarzenfeld) verdankt Franz Schrekers fünfte abendfüllende Oper ihren Titel. Aufgeweckt durch den Ruf „Irreloh“ schreibt Schreker später von jenem Halt am Dienstag des 25.März 1919 bei seiner Fahrt von Dresden nach Nürnberg, der ihn zu dieser Oper inspirierte. Gewidmet hat er sie seiner lieben Frau Maria. Innerhalb von drei Tagen war das Buch geschrieben, bis zur Uraufführung dauerte es aber dann doch vier Jahre (sie fand am 27. März 1924 in Köln statt).
Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Oper nur noch am Theater Bielefeld (1985) und an der Wiener Volksoper (2004) gegeben. So ist es jetzt ein Verdienst der Oper Bonn unter ihrem Generalintendanten Klaus Weise und dem Generalmusikdirektor der Stadt Bonn, Stefan Blunier, die beide ein besonderes Faible für selten gezeigte Werke des frühen 20. Jahrhunderts haben, das „Irrelohe“ nun nah am Ort seiner Uraufführung zu erleben ist. Unterstützt wurden sie hierbei von der Gastdramaturgin Janine Ortiz, die vor zwei Jahren eine lesenswerte, umfangreiche Studie über diese Oper (siehe auch Stücke-Infoseite) vorgelegt hat.

Oper Bonn
Heinrich – Graf von Irrelohe (Roman Sadnik), Peter (Mark Morouse), Eva (Ingeborg Greiner), Chor und Extra-Chor
Foto: Thilo Beu
Schrekers Opern (wie „Der Ferne Klang“ und „Der Schatzgräber“) wurden zu seiner Zeit öfter als die von Richard Strauss aufgeführt, er zählt zu den bedeutendsten Vertretern der musikalischen Moderne und doch nehmen seine Werke im heutigen Opernbetrieb nur eine Randstellung ein. Dabei bietet gerade „Irrelohe“ nicht nur ein fesselndes, zeitloses Thema, sondern auch eine einzigartige, entdeckungswerte, fantastische Musik, die Altes wie Neues würdigt. Angesiedelt hat Schreker das Stück im 18. Jahrhundert, zu einer Zeit, wo die Welt scheinbar noch in Ordnung war.
Gleichzeitig weist er gerade aber auch mit seinen komplexen Klangvorstellungen hin zum Expressionismus. Die für Schreker typische Mischung von Märchenfantastik und Milieurealismus findet sich auch hier. Für die Bonner Inszenierung hat Claus Weise das Stück behutsam in ein nicht näher bestimmtes ländliches Osteuropa der neueren Zeit verlegt. Die Schenke der Lola besteht aus modernen Ledergarnituren, mit offenem Hintergrund für den Dorfplatz mit alten LKWs. Im Hintergrund schimmert bedrohlich das Schloss von Irrelohe hervor. In seiner expressionistischen Ausführung erinnert es an das Frontispiz des Klavierauszugs. Wie auch die dortigen Flammen in Form von Fahnen auf der Bühne zu sehen sind. Statt einem Gemach mit Büchern (Heinrich wird eigentlich als Bücherfreund beschrieben), ist vom Inneren des Schlosses eine Art mondäne Garage zu sehen, mit einem schicken Cabriolet Oldtimer im Mittelpunkt (für Heinrich, dem Autonarr; Bühne: Martin Kukulies).
Die Gesamtatmosphäre ist unheilvoll, dunkel und düster (Licht: Thomas Roscher). So wie die Musik und die Probleme der Protagonisten. Jeder leidet und kann das Leiden doch nicht überwinden. Die Musik drückt die jeweiligen Gemütszustände stets fast wie ein Spiegelbild aus, wodurch es leicht wird, die Oper zu verstehen. Das Beethoven Orchester Bonn unter der Leitung von Stefan Blunier ist beim ständigen Wechsel zwischen Klangballungen und kammermusikalischen Introversionen ganz besonders gefordert und bietet alles. Was ob Schrekers Klangfarben und komplexen Klangvorstellungen sehr viel ist.
Wie auch die Sänger bis in die kleinste Rolle vollends überzeugen. Vielleicht hat sie alle auch die Tatsache, dass der Premierenabend für eine CD-Produktion aufgezeichnet wurde, zusätzlich motiviert. Roman Sadnik gibt einen leidenschaftlichen, kraftstrotzenden und charmanten Graf Heinrich (im schwarzen Leder wirkt er fast ein wenig wie ein junger und schlanker Mosshammer: Kostüme: Fred Fenner). Mark Morouse gibt dem Peter die passende tragische Note. Bezaubernd und mit leuchtenden Höhen die Eva der Ingeborg Greiner. In weiteren Rollen gefallen u.a.: Daniela Denschlag (Lola) und Mark Rosenthal (Christobald). Der um den Extrachor verstärkte Chor des Theater Bonn hat erst im dritten Akt seinen großen Auftritt, dieser ist dafür dann aber umso imposanter.
Eine Ausnahmestellung nimmt die Oper auch im Vergleich zu Schrekers anderen Opern ein, es gibt ein vorsichtiges Happy End (auch wenn Peter im Kampf getötet wurde und das Schloss in hellen Flammen aufging). Im forte fortissimo („mit Wucht und Größe, bewegt, aber doch etwas breit“) beginnt die Schlussszene, die mit dem Übergang des Feuers in rote Glut langsamer wird, dann wieder feierlich, um allmählich gesteigert und sehr breit (so die Anmerkungen Schrekers) das sich gefundene Liebespaar gemeinsam singen zu lassen: „Liebe hat die wilde Glut besiegt, die selige Lohe aus Nacht und Grauen. Nun mag kommen, was kommen mag, in uns ist Sonne, in uns ward es Tag!“. Die dumpfe Sucht ist überwunden, der Erbfluch ist mit dem quasi notwendigen Brand des Schlosses gebrochen, die beiden fahren mit ihrem Oldtimer davon, fast wie im Film („und wenn sie nicht gestorben sind…“). Viel begeisterter Applaus.
Markus Gründig, November 10
Die Walküre
Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 4. November 10
Erde. Wasser. Luft. Feuer. Walküre.
Auf ausnahmslos positive Resonanz stieß im vergangenen Mai die Rheingold-Inszenierung von Vera Nemirova an der Oper Frankfurt. Mit Spannung wurde jetzt die Fortsetzung der Ringgeschichte erwartet. Zuletzt wurde „Die Walküre“ in Frankfurt konzertant gegeben. Das war 2004 in der Alten Oper, es spielte die Sächsische Staatsoper Dresden unter Kirill Petrenko (designierter Generalmusikdirektor der Bayrischen Staatsoper). Damals weilte, Berichten zufolge, Wolfgang Wagner im Publikum. An der jetzigen Frankfurter Neuinszenierung hätte er sicher auch Gefallen gehabt, denn diese besticht szenisch wie musikalisch. Getreu dem Motto „weniger ist mehr“, verzichten Nemirova und ihr Bühnenbildner Jens Kilian auch für „Die Walküre“ auf opulente und neuzeitliche Bilder.
Dennoch gibt es auch hier für die vorgesehenen Spielorte („Das Innere der Wohnung Hundings“, „Wildes Felsengebirge“ und „Auf dem Gipfel eines Felsenberges“) eine beeindruckende abstrakte Bildsymbolik. Aus dem „Vorabend“ grüßen die bekannten großen, den gesamten Bühnenraum einnehmenden, konzentrischen Ringe. Diese sind nur noch anfangs bläulich gehalten, verändern ihre Farbe dann zu einem erdigen Braun, mitunter erscheinen sie auch in Form von Baumringen als Symbol für die Endlichkeit allen Lebens.
Nunmehr sind die Bühnenseiten auch offen, der Raum also schon nicht mehr ganz so geschlossen wie noch beim „Rheingold“. Nemirovas feines Gespür für eindringliche Optiken, bei offener Ästhetik, wird auch von dem dunkel gehaltenen, stimmungsvollen, warmen Licht (Olaf Winter) unterstützt. Wagners Leitmotivtechnik wird hierbei aufgriffen (siehe hierzu auch das Produktionsvideo der Oper Frankfurt zu „Die Walküre“, u.a. mit einem ausführlichem Statement von Olaf Winter). Im Hintergrund jagen immer wieder einzelne düstere Wolkenzüge „wie vom Sturm getrieben“ vorbei (Video: Bibi Abel).

© iStockphoto
Nemirova formt, ganz ohne Pathos, sehr genau die Figuren, sodass die Einzelnen eine starke Plastizität gewinnen. Von musikalischer Seite sorgt das jüngst erneut als „Orchester des Jahres“ ausgezeichnete Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung seines charismatischen Generalmusikdirektors Sebastian Weigle für einen sängerfreundlichen, transparenten Klang. Selbst beim „Walkürenritt“ wird ein süffiger Zugriff auf Wagners Musik vermieden, vielmehr wird die dunkle Poesie dieser Musik plastisch fühlbar, das Scheitern Wotans, sein tragischer Konflikt bezüglich Brünnhilde, zum emotionalen Höhepunkt.
Auch sängerisch kann sich das Frankfurter Publikum glücklich schätzen. Bekannte Gastsolisten und Ensemblemitglieder boten eine starke Leistung. Terje Stensvold stach bereits im „Rheingold“ als Wotan hervor, bei der „Walküre“ ist er noch präsenter, noch fokussierter seine genaue Stimmführung. Des Göttervaters Lieblingswalküre, Brünnhilde, verkörpert die dramatische Sopranistin Susan Bullock. Im ersten Akt eher wie ein liebes Pumuckl denn als Göttergeschöpf wirkend (Kostüme: Ingeborg Bernerth), gewinnt sie als sich für die Liebe einsetzende Kämpferin im zweiten Akt gehörig Format und rührt im finalen dritten Akt mit viel Glanz in der Emphase beinahe zu Tränen. Ein hohes Maß an Verständlichkeit bietend, glänzt sie mit ihrem farbenreichen Sopran.
Das inzestuöse Liebespaar Sieglinde und Siegmund ist auch im realen Leben ein Paar: Eva-Maria Westbroek und Frank von Aken. Westbroek hat, wie die meisten der anderen auch, ihre Rolle schon mehrfach an anderen Häusern gesungen. Mit entsprechender Souveränität und Leichtigkeit meistert sie auch schwierigste Passagen, ergreifend im Piano und mit viel Kraft bei strahlenden Ausbrüchen. Ensemblemitglied Frank van Aken hat den Siegmund u.a. bereits bei der viel beachteten Meininger Ring-Produktion im Jahr 2001 gesungen (unter Kirill Petrenko). Hier zeigt er einen kraftstrotzenden Kämpfer, der aber auch mit warmen, lyrischen Tönen und frischer Stimme ganz für sich einnimmt. Sein Hausdebüt gibt mit dieser Produktion Ain Anger in der Rolle des Hunding. Ist er auch Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, kann man nur hoffen, dass er bald wieder einmal in Frankfurt singt. Denn selbst in der kleineren Rolle des Hundings fällt er mit seinem kultivierten, unangestrengt wirkenden Baß positiv auf. Die Fricka der Martina Dike ist eine auch vokal durchsetzungsfähige Gattin mit starker Persönlichkeit und ausdrucksstarker Stimme.
Erfreulich auch das homogene Bild der acht Walküren (Gerhilde: Anja Fidelia Ulrich, Ortlinde: Mona Somm, Waltraute: Eve-Maud Hubeaux, Schwertleite: Bernadett Fodor, Helmwige: Christiane Kohl, Siegrune: Lisa Wedekind, Grimgerde: Tanja Ariane Baumgartner, Roßweiße: Monika Bohinec), die mit Brustpanzern und Sturmfrisurkampfhelmen leidenschaftlich und doch erfolglos für Brünnhilde eintreten.
Statt einem Feuerstrahl, der aus einem Stein hochfährt, senkt sich zur Umhüllung der in einen Tiefschlaf versetzten Brünnhilde ein Feuerring herab. Ein eindringliches, in Erinnerung bleibendes Schlussbild. Nicht enden wollender Jubel, Standing Ovations und eine wie eine Prinzessin strahlende Vera Nemirova beim Schlussapplaus.
Markus Gründig, November 10
Hoffmanns Erzählungen
Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 10. Oktober 10
Ein Mann mit Dreitagebart, im Dunst von Alkohol und Rauschmitteln… Das Plakat der Oper Frankfurt für ihre jüngste Produktion lässt zunächst vermuten, es gehe um ein Rockkonzert in der Batschkapp oder im Sinkkasten. Dabei handelt es sich um die ehrwürdige Oper Frankfurt, die gerade erneut zum besten Opernhaus Deutschlands ausgezeichnet wurde (vgl. auch hierzu die kulturfreak.de NEWS vom 9. Oktober 10). Das Plakat wirbt für die Neuinszenierung von Jacques Offenbachs Opéra-fantastique „Hoffmanns Erzählungen“, die zwischen den Neuinszenierungen von Ariberts Reimann „Medea“ und Richard Wagners „Walküre“ gezeigt wird und sich an ein breites Publikum richtet, schließlich enthält „Hoffmanns Erzählungen“ so populäre Stücke wie die Ballade von Kleinzack und die, aus den Rheinnixen entlehnte, „Barcarole“.
Offenbach ist vor allem als Operettenkomponist bekannt („Orpheus in der Unterwelt“, „Die schöne Helena“, „Pariser Leben“ u.v.m.). Zuletzt hat er sich aber auch der Grand Opera zugewandt. Geschaffen hat er aber eine eigene Form, eben die Opéra-fantastique. Beenden konnte Offenbach seinen „Hoffmann“ nicht mehr, er starb bei den Proben und das Ende blieb unvollendet. Aus verschiedenen Quellen wurde seitdem das Ende konstruiert bzw. versucht, aus gefundenem Material möglichst nah an Offenbach heranzukommen. Jede der derzeit gespielten Fassungen hat ihre Vor- und Nachteile. Die Oper Frankfurt hat nach Information des Chefdramaturgen Dr. Norbert Abels eine eigene Strichfassung erstellt, die zum großen Teil der Oeser-Fassung folgt. So stirbt Hoffmann nicht am Ende, sondern zieht mit seiner Muse davon. Gespielt wird inklusive einer Pause knapp drei Stunden.
Für das Künstlerdrama, bei dem drei Frauenbegegnungen in einen Kneipenbesuch eingerahmt sind, lassen sich phantastische Bilder vorstellen. Die Realität ist nüchterner. Boris Kudličkas Bühne besteht aus einem großen schwarzen Kasten, der mit vielen Leuchten in Stabform an Decke und Wänden in viele Quadrate aufgeteilt ist. Eine weiße Bar steht für Hoffmanns Lieblingsweinstube. Für die einzelnen Damenakte wird ein kleinerer containerförmiger Raum (Spalanzanis physikalisches Kabinett) (Olympia-Akt), ein Flügel (Antonia-Akt) oder eine Treppe nebst Laufsteg (Giulietta-Akt) auf die Bühne geschoben bzw. herabgelassen. Nicht zu vergessen ein Transportband für weitere Roboterfrauen und Discokugeln.
Regisseur Dale Duesing führt mit leichter Hand durch die Hoffmannschen Träume, ohne allerdings nachhaltige Eindrücke zu hinterlassen. Dies tun dafür die Sänger umso mehr. Allen voran Alfred Kim in der Rolle des liebestrunkenen Hoffmann. Kim verfügt über erstaunliche Kraftreserven und veredelt auch die spitzen Töne mit tenoralem Glanz. Bei den drei Damen besticht vor allem Brenda Rae als Olympia mit ihren Koloraturen und ihrem herzhaften Spiel als Roboterfrau. Zurückhaltender, aber nicht minder klangschön: die Antonia der Elza van den Heever und die Giulietta der Claudia Mahnke.
Der von Matthias Köhler einstudierte Chor konnte sich vor allem im ersten Teil wirkungsvoll einbringen. Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Roland Böer griff Dale Duesings leichtes Spiel auf und trumpfte mit einem zarten Gewebe von Klängen auf, die Extreme mieden und dafür die Facetten der Offenbachschen Musik von Heiterem bis Ernstem offenlegte. Vom Publikum gab es am Ende nicht nur einen lang anhaltenden Schlussapplaus, sondern bereits vorher schon reichlich Zwischenapplaus.
Markus Gründig, Oktober 10
Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg
Staatstheater Mainz
Besuchte Vorstellung: 17. September 10 (Premiere)
Auf „Tannhäuser“-Vorstellungen können sich vor allem Männer freuen, schwankt die Hauptperson doch zwischen Eros und Moral, zwischen der Höllenkönigin Venus und der heiligen, sittsamen Elisabeth. Folglich gibt es bei den Inszenierungen dann auch reichlich „Fleisch“ zu sehen. Oft, aber nicht immer. Und schon gar nicht in Mainz. Denn hier schaut jetzt eine Frau mit kritischem Blick auf die Figur des Tannhäuser. Regisseurin Sandra Leupold reduziert nicht nur radikal bei ihrer szenischen Umsetzung, sie rückt gleichzeitig auch die fromme Dulderin Elisabeth in den Mittelpunkt (was sich schon exemplarisch auf dem Titelbild des Programmhefts andeutet, auf dem die bereits der Welt entrückte Elisabeth gezeigt wird und nicht der ewige Zauderer Tannhäuser) und entgöttert die Venus.
Beide Figuren stehen sich hier wesentlich näher (nicht nur optisch). Leupold verzichtet bugetfreundlich auf opulente Bilder für Venusberg, Sängerhalle und Talblick. Bei der spartanisch ausgestatteten Bühne (Tom Musch) wähnt man sich eher wie in einer zeitgemäßen Schauspielinszenierung (die Seiten sind nicht verhangen, die Rückwand besteht aus einem kahlen Wellblech und die Bühnenscheinwerfer sind zu sehen). Auf der Bühne befindet sich lediglich ein Quadrat aus 27 blanken Tischen (mit unterschiedlich gefärbten Oberseiten). Es herrscht eine dunkle, nüchterne und irgendwie bedrohliche Atmosphäre.
Angesiedelt in der konservativen Biedermeierzeit, ist es kein Wunder, dass hier kein Platz für Freude, Lust oder gar Eros ist. Nicht nur Elisabeth trägt ein langes schwarzes Kleid, dass ihren Körper bis auf Kopf und Hände verdeckt, selbst Venus, ohne rote Lippen und ohne tief geschnittenem Dekolleté tut es ihr gleich und ist bis zum Hals zugeknöpft (wobei sie das Oberteil theoretisch öffnen könnte). Die Wartburgsänger und das gemeine Volk tragen überwiegend Kostüme in dunklen Farben aus der Zeit des Vormärz. Einzig Tannhäuser fällt optisch als Mensch der Gegenwart mit Jeans und Turnschuhen aus dem Rahmen (Kostüme: Julia Burde).
Leben in diesem erosfreien Nirgendwo religiöse Fundamentalisten, die jegliche Form von Leidenschaft verachten? Wobei, für eine kurze Sequenz im ersten Akt gibt es dann doch tatsächlich Möpse und Mösen zu sehen. Dies aber als überzogene Karikatur, nach dem Motto „Das kann es ja wohl nicht sein, was zählt“.

Staatstheater Mainz
Elisabeth (Bettine Kampp), Tannhäuser (Alexander Spemann), Venus (Patricia Roach), Chor
Foto: Martina Pipprich ~ martina-pipprich.de
Herkömmlichen Besuchererwartungen verweigert sich Leupold also gründlich. Und schafft dadurch aber auch Raum für Neues (wie sie nebenbei auch dem Geschmack vieler Frauen entspricht, denen die ständige Fleisches-Lust-Präsentation bei der Venusbergszene ein Gräuel geworden ist). Trotz der reduzierten Bühnenoptik zeigt sie Bilder, die erstaunen und zum Nachdenken anregen. Sei es am großen, zusammengesetzten Tisch, der familiär eine systemkonforme Gemeinschaft herstellt (die aber ins Wanken gerät) und Zentrum für Elisabeths „Hallenarie“ ist. Oder später bei den schulmäßig stehenden Tischen beim Sängerstreit, die zu neuen Formationen zusammen gerückt werden und ein Tisch schließlich als Fläche für die aufgebahrte Elisabeth mahnend im Bühnenmittelpunkt steht. Das hierbei die Dresdner Fassung gezeigt wird, ist dann auch konsequent, passt das lustfördernde Bacchanal der Pariser Fassung nun mal nicht zum Inszenierungsansatz.
Die beiden Frauenrollen wurden deutlich aufgewertet. Da Venus unaufhörlich im Kopf von Tannhäuser rumgeistert, wandert sie beim Sängerwettstreit physisch durch die ihr fremde Wartburggesellschaft (bei der sie ja eigentlich nichts verloren hat) und stellt sich am Ende deutlich vor Elisabeth, um Tannhäuser doch noch für sich zu gewinnen. Publikumsliebling Patricia Roach strahlt trotz züchtiger Tracht Reize und Wärme aus und besticht vor allem aber mit ihrem warmen Sopran. Bettine Kampp ist als Elisabeth nicht nur sängerisch stark gefordert (wobei sie ihre Stimme überaus sicher führt), sondern auch schauspielerisch. Das geht bis hin zum beseelten, pantomimischen Spiel, wenn sie mit Schmerz verzerrtem Gesicht hoch fährt und ihre große innere Not deutlich nach außen kehrt.
Alexander Spemann braucht ein paar Takte, bis er den vollen Glanz seiner kräftigen Tenorstimme vorführt, nimmt sich beim 2. Akt ein wenig zurück, um dann im dritten Akt die anstrengende Partie mit viel Strahlkraft zum vokalen Höhepunkt zu führen. Zögerlich, zurückhaltend der Wolfram von Eschenbach des Patrick Pobeschin, der dafür mit schönem Timbre für sich einzunehmen weiß. Der Sängerwettstreit ist solide geraten, es ist jedoch kein euphorischer, couragierter Sängerkampf. Die Männer haben scheinbar keine Ideale, nichts, woran sie glauben und zu kämpfen bereit sind. Sängerisch durchaus sehr solide, aber kein glanzvoller Höhepunkt (Hermann, Landgraf von Thüringen: Hans-Otto Weiß, Walther von der Vogelweide: Alexander Kröner, Biterolf: Heikki Kilpeläinen bass, Heinrich der Schreiber: Lucas Vanzelli , Reinmar von Zweter: Martin Js.Ohu ). Stark gefordert ist der von Sebastian Hernandez-Laverny wunderbar einstudierte Chor, denn er hat auch szenisch viel zu tun. Das Philharmonische Staatsorchester Mainz unter seiner Leiterin Catherine Rückwardt (im eleganten schwarzen Fledermauskleid) sorgt für eine eindringliche, feinnervige und effektvolle Interpretation.
Nach gut 4 ½ Stunden gibt es keinen Sieger, nur Verlierer. Das Volk dringt nach vorne, Venus versucht sich ebenfalls nach vorne durchzuschlagen, wird aber von den Pilgermassen zurückgedrängt. Diese verkünden lieber lautstark, dass dem Büßer Tannhäuser von höchster Stelle Heil erteilt worden ist. Eine Reflexion über das, was Ungeheuerliches gerade passiert ist, über die eigene Verantwortung oder das eigene Leben, findet nicht statt.
Statt tiefer Betroffenheit im Publikum, ob der mahnenden szenischen Umsetzung, sorgen etliche Buhrufe und auch starker Applaus für Stimmung im Saal. Leupolds Streben hinter dem oberflächigen Künstlerdrama und dem Eros-Anstand-Konflikt, die im „Tannhäuser“ tiefer liegenden Grundfragen des Lebens, Wagners Utopie vom Leben in Liebe und Freiheit aufzufächern, zwingt natürlich auch das Publikum zum Nachdenken. Und das will manchmal lieber nur dumpf und selbstsüchtig konsumieren. Aber vielleicht brauchen die Buhrufer auch nur etwas mehr Zeit zum Nachdenken.
Markus Gründig, September 10
Medea
Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 12. September 10
Als im Februar 2010 in der Wiener Staatsoper Aribert Reimanns „Medea“ uraufgeführt wurde, war dies schon eine Besonderheit, denn die letzte Uraufführung lag schon einige Jahre zurück. Mit dem Auftragswerk „Medea“ an Aribert Reimann setzte sich, wie die Wiener Presse berichtete, Operndirektor Ioan Holender im Februar dieses Jahres eine bemerkenswerte Marke für seine sodann im Juni beendeten Tätigkeit. Das Frankfurter Publikum hat es diesbezüglich besser. Nicht nur hinsichtlich Uraufführungen, sondern auch im Hinblick auf zeitgenössische Bühnenwerke und Opernraritäten. Wenn auch „Medea“ nicht in Frankfurt uraufgeführt wurde, fand jetzt zumindest die deutsche Erstraufführung in Frankfurt statt. Im Schauspiel nebenan, war das Stück im September 2007 von Urs Troller inszeniert worden. Die Inszenierung war ein großer Publikumserfolg und auch die Opernversion wird sicher auf ein ebenso hervorragendes Echo stoßen. Zumal das Frankfurter Publikum durch die Spielplanpolitik der Oper schon gut vorbereitet wurde. Vor zwei Jahren eröffnete Aribert Reimanns „Lear“ die Saison. „Medea“ ist nach Reimanns eigener Aussage das Pendant dazu. Steht mit der mysteriösen Medea doch eine Frau im Zentrum der Oper.
Wien und Frankfurt stehen sich bei dieser Oper nahe, denn es handelt sich bei „Medea“ um eine Gemeinschaftsproduktion der Wiener Staatsoper und der Oper Frankfurt (mit identischem Bühnenbild und Regieteam). Als Textbasis verwendete Aribert Reimann die Medea Erzählung aus Franz Grillparzers Triologie „Das goldene Vlies“, die er allerdings stark kürzte. So erzählt die gut zweistündige, zweiaktige Oper nur über einen relativ kurzen Zeitrahmen. Reimann richtet den Fokus auf die Außenseiterrolle Medeas und auf das Thema Besitz fremden Eigentums. Damit hat er gleichsam aktuelle Bezüge zur Gegenwart geschaffen. Die Fremde, die Andersartige, die nicht integrierbare Medea ist eine Außenseiterin. Der geliebte Mann hat eine andere Frau, die Kinder ziehen sich zur „neuen“ Mutter mehr hingezogen und König Kreon vertreibt sie aus dem Land: Von wegen gute alte Zeit.

Oper Frankfurt
Medea (Claudia Barainsky) und Jason (Michael Nagy)
Foto: Barbara Aumüller ~ szenenfoto.de
Der Italiener Marco Arturo Marelli ist nicht nur für die Regie zuständig, sondern auch für das Bühnenbild und das Licht. Das Einheitsbühnenbild zeigt eine große Fläche, voll mit erkalteten Lavasteinen. Eingefaßt in ein hohes Halbrund ist dieses Korinth ein Ort, wo einst Leben war. Jetzt ist es ein kalter, menschenleerer Raum. Medea haust hier halb in einem Erdloch, nur ein kleines Zelt dient ihr als Schutzraum. König Kreons Burg dagegen ist ein großer gläserner Kubus, der seitlich hoch oben über der Bühne schwebt, sich herab senkt oder über eine große Metalltreppe erklommen werden kann. Die Gesamtatmosphäre ist dunkel und düster. Später öffnet sich die Hinterwand und ein weiterer Geröllberg ist erkennbar. Zum Finale hin purzeln von dort bedrohlich Steine und Felsen Richtung Bühnenrand herab.
Aribert Reimanns Musik setzt das Geschehen in plastische und drastische Töne um. Doch es gibt auch die zarten, sanften, beinahe liebevoll klingende Töne der Streicher, wenn beispielsweise Medea das Gespräch mit Jason sucht. Wie generell, grob gesagt, die Streicher für die Musikwelt Medeas stehen und das Blech und Schlagzeug für die Welt von Jason und Kreon.
Hervorragend ist wieder mal die sängerische Leistung. Die Reimann erfahrene Claudia Barainsky besticht mit ihrer klaren Stimme und bewältigt die immensen künstlerischen Herausforderungen der vielen Koloraturen bravourös. Dabei ist sie kein hysterisches Weib, sondern selbst in den verzweifelten Momenten eine warmherzige, liebende Frau und Mutter (das Töten der Jungs wird übrigens nicht gezeigt), die durch die erfahrenen Schicksalsschläge zur Verzweiflungstäterin wird.
Ensemblemitglied Michael Nagy wurde vor Vorstellungsbeginn als stimmlich indisponiert angekündigt. Doch trotz Halsprobleme durch eine Erkältung sorgte er für innige Momente und gefiel mit seinem angenehmen Timbre und smarten Spiel. Sein Debut an der Oper Frankfurt gibt bei dieser Produktion der Tenor Michael Baba in der Rolle des Kreon. Er begeisterte mit konditionsstarker Strahlkraft in der Stimme.
Kreons Tochter Kreusa, die alte und neue Liebe Jasons, ist hier sehr sympathisch gezeichnet (mit ihrem weißen Dress und blonden Haaren wirkt sie ein wenig wie Meryl Streep). Sie geht auf die Kinder ein, akzeptiert sie, kümmert sich um sie und hat selbst noch Verständnis für Medea, so dass sie ihr die Buben zum Abschied schickt. Ihr Tod ist zwar effektvoll mit glühend rotem Licht, Rauchschwaden und verzweifelten Armbewegungen hinter Jalousien in Szene gesetzt, doch so ganz nachvollziehbar ist es nicht, warum hier Medea einen so großen Hass auf Kreusa hat. Paula Murrihy singt die Rolle der Kreusa mit großer Hingabe.
Einen effektstarken Auftritt hat der vom Stuhl der Amphiktyonen gesandte Herold. In seinem, wie einem Science-Fiction-Film entliehenen, Mantel (Kostüme: Dagmar Niefind) und weiss geschminkten Kopf, füllt Countertenor Tim Severloh die Rolle mit starker Mimik und spitzen Tönen aus. Tanja Ariane Baumgartner gefällt in der kleinen Rolle der Gora (Amme von Medea).
Reimanns Musik packt jeden, wenn auch auf unterschiedlicher Weise. Sie lässt einen nicht ruhig in den Zuschauersessel sinken und läuft sehr synchron mit der krassen Handlung. Anders als bei Verdi oder Wagner ist sie viel unmittelbarer. Unter der Leitung von Erik Nielsen spielte das Frankfurter Opern- und Museumsorchester oftmals harte und prägnante Töne und entfachte ein überaus vielschichtiges Klanggefüge mit extremen Eruptionen. Fazit: Ein vielversprechender Saisonauftakt.
Markus Gründig, September 10



