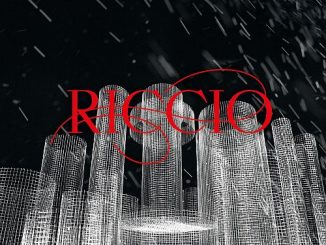„Der Mensch ist, wozu er sich macht. “
(Jean-Paul Sartre, Der Existentialismus ist ein Humanismus)
„Wenn wir über die Natur der menschlichen Existenz nachdenken, erinnert uns Jean-Paul Sartres berühmtes Diktum „Der Mensch ist, wozu er sich macht“ an die weitreichende Verantwortung eines jeden Einzelnen für die Ausgestaltung des individuellen Seins und der eigenen Existenz. „Die Existenz geht der Essenz voraus“, formulierte Sartre an anderer Stelle und deutete damit an, dass das Menschliche keine feste, von der Natur vorgegebene Existenzform sei, sondern ein dynamischer Prozess des Werdens.
Somit sind wir aufgefordert, uns selbst als Schöpferıinnen unseres eigenen Schicksals zu begreifen und Sinn in eine Welt zu projizieren, die uns diesen nicht a priori bereithält.
Jede Entscheidung, die wir treffen, beeinflusst demnach unsere Essenz; mit jeder Niederlage und jedem Sieg, jedem Scheitern und jedem Erfolg gestalten wir das Wesen, zu dem wir werden. Die Spielzeit 2025-26 steht im Einklang mit diesem Thema, denn jede Erzählung unserer Neuinszenierungen zeugt von Prozessen der Selbsterschaffung und den Konsequenzen der Entscheidungsfreiheit des Menschen.
In Giuseppe Verdis Rigoletto verfängt sich der tragische, gequälte Narr in den Netzen von Rache und Liebe, und sein Schicksal hallt wider in Friedrich Nietzsches Mahnung: „Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zu sehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird.“ Rigolettos Kampf zeigt uns, dass jede Tat Auswirkungen auf unser Sein hat, manchmal auf eine unheilvolle, nur schwer erträgliche Weise.
In Charles Gounods Faust begegnet uns ein Mann, der bereit ist, seine Seele aufs Spiel zu setzen, um Wissen und Macht zu erlangen. „Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss“, mahnt uns die literarische Vorlage, Goethes unsterbliches gleichnamiges Drama, das eindrucksvoll die Gefahren eines Verlangens aufzeigt, das die Seele verzehrt.
Einen existenziellen Kampf ficht auch Brünnhilde in Richard Wagners Die Walküre aus. Sie ringt mit den Grenzen und Widersprüchen von Liebe und Pflicht- ein klassischer Opernkonflikt also, der hier insofern ins Universelle ausgeweitet ist, als Brünnhilde als Tochter des obersten Gottes Wotan über dem Gesetz der Menschen steht und das Schicksal herausfordert.
Auch die Zauberin Alcina in Georg Friedrich Händels gleichnamiger Oper versucht, die Realität nach ihrem Willen zu formen. Doch ihre magischen Kräfte wenden sich letztlich gegen sie selbst.
Das übernatürliche Element kommt auch in Nikolai Rimski-Korsakows Die Nacht vor Weihnachten zum Vorschein. Hier führt es dazu, dass die Figuren auf der Suche nach dem eigenen Glück die Möglichkeit zur Transformation in einer Welt voller Licht und Schatten erhalten.
In Hans Werner Henzes Die englische Katze wird die Frage nach der Selbstbestimmtheit des Menschen auf der Ebene des gesellschaftlichen Zusammenlebens verhandelt. In Form einer Tierparabel wird unser Streben nach Individualität, das oft im Widerspruch zu den sozialen Normen steht, auf den Prüfstand gestellt. Das komplexe Wechselspiel zwischen Konformität und Selbstbestimmung wird hier zum Gegenstand einer beißenden Satire.
Und schließlich zeigt Brett Deans Oper Of One Blood, die an der Bayerischen Staatsoper uraufgeführt wird, zwei in ihren persönlichen Ambitionen gefangene Herrscherinnen: Mary Stuart und Elizabeth l. Sie handeln im Gegensatz zu Hannah Arendts Einsicht, wonach Macht nur dort Wirklichkeit wird, wo Worte und Taten untrennbar miteinander verflochten sind. Diese Herrscherinnen, gefangen in einem brutalen Konflikt zwischen ihrem politischen und privaten Schicksal, erinnern uns daran, dass Herkunft und Identität meist untrennbar miteinander verbunden sind.
Das Programm der Münchner Opernfestspiele 2026 fügt sich in diese Reflexion über Existenz und Selbstbestimmung ein. Das alljährlich stattfindende Festival bietet die Gelegenheit, die aktuelle Spielzeit der Bayerischen Staatsoper mit zwölf Opernproduktionen sowie zahlreichen Ballettaufführungen und Konzerten zu erleben. Den Festspiel-Fokus bildet diesmal eine Debattenreihe mit dem Titel „Plädoyers“, bei der die moralischen Implikationen so ikonischer Figuren wie Leonore aus Ludwig van Beethovens Fidelio, die königlichen Heldinnen aus Brett Deans Uraufführung Of One Blood und Max aus Carl Maria von Webers Der Freischütz unter die Lupe genommen werden.
All diese Hero:innen werden zum Spiegelbild unserer eigenen Suche nach Identität und Sinn. Die komplexen psychologischen Vorgänge, die ihrem Handeln zugrunde liegen, werden in unserer Debattenserie aus juristischer wie auch aus moralischer Perspektive ausgelotet und beurteilt. Dieser Dialog zwischen Oper und philosophischer Reflexion schafft einen einzigartigen Raum, in dem Kunst und Denken aufeinandertreffen und ein vertiefendes Theatererlebnis für das Publikum von heute sowie von morgen ermöglichen und die Relevanz der Gattung Oper unterstreichen.
Die wechselhaften Schicksale der vor weitreichenden Entscheidungen stehenden Figuren unserer Neuproduktionen werden interpretiert von international gefeierten Künstler:innen. Vladimir Jurowski, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, wird die faszinierende Klangwelt in Rimski-Korsakows Die Nacht vor Weihnachten in der Inszenierung von Barrie Kosky zum Leuchten bringen und in Die Walküre im Verbund mit Regisseur Tobias Kratzer der Dramatik, aber auch der feinen Psychologie in Wagners zweitem Ring-Werk nachspüren.
Musikalisches Neuland erkundet Jurowski in der Uraufführung von Brett Deans Of One Blood., in Szene gesetzt von Claus Guth. Nathalie Stutzmann gibt ihr Debüt in Gounods Faust. Als Regisseurin kehrt Lotte de Beer an die Bayerische Staatsoper zurück. Verdis Rigoletto dirigiert Maurizio Benini, Barbara Wysocka führt Regie. Mit Alcina stellt sich Johanna Wehner erstmals als Regisseurin an der Bayerischen Staatsoper vor, Stefano Montanari dirigiert die Händel-Oper. Im Cuvilliés-Theater steht Katharina Wincor bei Henzes Die englische Katze am Pult, Regisseurin ist Christiane Lutz.
DAS BAYERlSCHE STAATSBALLETT
Die erste Premiere der Ballettcompagnie, ein dreiteiliger Abend mit dem Titel Waves and Circles, ist ein Programm voller Kontraste. Maurice Béjart und William Forsythe, zwei der wegweisenden Choreographen des 20. Jahrhunderts, werden mit den beiden Werken Bolero und Blake Works I einer choreographischen Handschrift der jüngsten Generation gegenübergestellt. Die kanadische Choreographin Emma Portner arbeitet für ihre neueste Kreation erstmals mit einer deutschen Compagnie. Auch musikalisch wird der Abend eine große Vielfalt bieten, Forsythe und Portner arbeiten mit Songs aus verschiedenen Genres der Popularmusik, Béjart hingegen bezieht seine Energie aus Maurice Ravels mitreißender lnstrumentationsstudie für Orchester, die von Anfang an in einem Tanzkontext stand.
Rechtzeitig vor Weihnachten zeigt das Bayerische Staatsballett die Wiederaufnahme von John Neumeiers Der Nussknacker. Der Choreograph hat hier ein jugendliches Empfinden von Freiheit thematisiert: Marie steht am Beginn ihrer Pubertät und ist beeindruckt von ihrer älteren Schwester und deren Galan; sie nutzt das Potenzial des Träumens, um die im Raum stehenden und durch die geringfügig älteren Personen in ihrem Umfeld verkörperten Lebensentwürfe für sich selbst zu überprüfen.
Zum Auftakt der Ballettwoche 2026 präsentiert das Bayerische Staatsballett einen weiteren dreiteiligen Abend mit dem Titel Common Ground. Hier gehen Werke von Hans van Manen, Alexander Ekman und Johan Inger eine spannende Verbindung ein. Sowohl Ekman als auch van Manen verwenden dabei Musik von Ludwig van Beethoven – ein Komponist, der wie kein Zweiter für Freiheit steht.
Im Mai 2026 wird dann eine weitere Erfolgsproduktion wieder aufgenommen, die John Neumeiers choreographische Handschrift trägt: das zu Musik Frédéric Chopins komponierte Handlungsballett Die Kameliendame. Dessen Protagonistin Marguerite hat als Kurtisane die bürgerlichen Normen willentlich überschritten, reklamiert aber für sich dennoch das Recht auf die Erfüllung des Verlangens nach der großen, einzigen Liebe.
Zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele 2026 lanciert das Bayerische Staatsballett mit Konstellationen ein neues Format, in welchem Bestandteile des eigenen Repertoires neu kombiniert werden – mit dem Ziel, überraschende Bezüge und Querverbindungen zwischen den Stücken aufzuzeigen.
DAS BAYERISCHE STAATSORCHESTER
Das Ringen des Menschen um seinen angemessenen Platz und Stellenwert in der Welt ist ein Thema, das sich durch die Programme der Akademiekonzerte zieht. Sei es in den Werken von Dmitri Schostakowitsch, der zwischen ideeller Überzeugung und ideologischer Gängelung einen schmalen Grat für sein Leben und Schaffen finden musste, oder in der Musik der Romantiker Robert Schumann (in der kongenialen Orchester-Überschreibung durch Hans Zender) und Johannes Brahms, der in seiner ersten Symphonie nicht nur dem Schatten Beethovens zu entkommen versuchte, sondern ganz neue symphonische Bahnen ging.
Auch Brahms‘ erstes Klavierkonzert sollte einmal eine Symphonie werden und ist in seiner endgültigen Form der wohl extremste Ausdruck der Spannung zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv. Piotr I. Tschaikowskis vierte Symphonie gibt wie kaum ein zweites Orchesterwerk die akute Verzweiflung und endliche Überwindung einer existenziellen Krise in Klängen wieder. Sergei W. Rachmaninows Die Toteninsel schlägt die Brücke zum Jenseits, Richard Strauss illustriert die Gedanken des Über-Philosophen Zarathustra zwischen symphonischer Monumentalität und ironischer Brechung, und Hector Berlioz weitet das Klangspektrum ins Visionäre.
GMD Vladimir Jurowski dirigiert zwei der sechs Programme, von denen eines auch in dreien unserer westlichen Nachbarländer erklingen soll. Sebastian Weigle ist von vielen Opernvorstellungen her schon ein vertrauter Name am Nationaltheater München und dirigiert nun erstmals ein Akademiekonzert, während Markus Poschner und Pablo Heras-Casado zum ersten Mal überhaupt an der Bayerischen Staatsoper auftreten. Die Rückkehr unseres ehemaligen Chefdirigenten Kirill Petrenko wird wie immer mit großer Spannung erwartet. Am Klavier geben mit Beatrice Rana und Daniil Trifonov zwei herausragende Solistıinnen ihr Debüt in den Akademiekonzerten. Aus den eigenen Reihen des Bayerischen Staatsorchesters werden Solocellist Yves Savary und Solotrompeter Johannes Moritz zu erleben sein. Besonders erfreulich ist, dass der Bariton Christian Gerhaher erneut ein Akademiekonzert mitgestaltet.
„Der Mensch ist, wozu er sich macht“ wird in dieser Spielzeit zu einem Leitmotiv, das uns nicht nur auf spannende theatrale Entdeckungsreisen mitnimmt, sondern uns auch die eigenen Kämpfe um Freiheit, ldentität und ein selbstbestimmtes Leben vor Augen führt. Wir werden Zeugıinnen der Aufschwünge und Abstürze des menschlichen Geistes – ein Echo unseres eigenen fortwährenden Strebens, uns selbst in einer Welt zu erschaffen, die uns dazu herausfordert, zu dem zu werden, was wir sind.
Der Vorhang der Bayerischen Staatsoper wird in der Spielzeit 2025-26 etwas später als gewöhnlich aufgehen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten werden wir Sie, unser Publikum, Ende Oktober wieder begrüßen. Allen Begegnungen mit Ihnen in unserer neuen Spielzeit sehe ich mit größter Vorfreude entgegen.“ Serge Dorny (Staatsintendant der Bayerischen Staatsoper)
Ausführliche Informationen finden sich unter staatsoper.de.