
Agrippina
Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 25. Juni 06
Iulia Agrippina (15 – 59 n.Chr.) war dreimal verheiratet und hatte aus ihrer ersten Ehe den Sohn Nero. Schon damals wollten Mütter nur das Beste für ihre Kinder. In diesem Fall strebte Agrippina für ihren Sohn bescheiden den Kaiserthron an, den ihr dritter Ehemann (und Onkel) Claudius innehatte. Claudius wurde von Agrippina kurzerhand vergiftet und Nero zum neuen Kaiser ausgerufen. Nero machte sich nicht nur als rücksichtsloser Despot und vermeintlicher Brandstifter Roms einen Namen, sondern ließ seine Mutter (die ihn später wieder vom Thron stoßen wollte) samt Schiff im Mittelmeer untergehen. Es herrschten schon raue Sitten im alten Rom, in der guten alten Zeit.
Doch davon ist bei Georg Friedrich Händel´s Oper Agrippina wenig zu spüren, sie beschränkt sich darauf zu zeigen, wie es Agrippina mit List, Intrigen und etwas Glück schafft, dass Nero den Kaiserthron besteigen kann. Librettist Vincenzo Grimani fügte für dieses Portrait noch ein paar Liebesgeschichten ein und am Ende herrscht eitel Sonnenschein, weil jeder das bekommen hat, wonach er sich gesehnt hat. Die Historie diente lediglich als Gerüst, Morde und Exzesse gibt es hier nicht.
In der bewegungsreichen Inszenierung des 39jährigen schottischen Regisseur David McVicar, eine vom Brüsseler Théâtre Royal de la Monnaie übernommene (aber neu einstudierte) Produktion vom Mai 2000 ist Blut nur im gemalten Bühnenvorhang zu sehen, dass aus dem Maul einer Wölfin tropft (eine Anlehnung an die kapitolinische Wölfin, die „Pflegemutter“ von Romulus und Remus). Dass die Handlung an mächtiger Stelle spielt, wird durch zeitlose, große, dunkle und variable Quader verdeutlicht. Groß auch eine grell gelbe Treppe, mit dem kaiserlichen Thron auf der Spitze. Zu dumm dass da nur Platz für einen ist. Denn viele wollen hinauf. Zu Beginn und Ende befinden sich die Sänger jeweils auf Sarkophagen mit ihrem Namen, die auch wie Sockel von Denkmälern wirken, für die sie für die Dauer der Oper herabsteigen, die Oper als Zeitfenster in die Vergangenheit (Bühnenbild und Kostüme: John Macfarlan).
Die Kostüme sind modern: die Männer Roms in Militärkleidung, die beiden Damen in eleganten Kostümen. Kaiser Claudius (schelmisch und eher etwas naiv als staatsmännisch, zwischen den Damen hin und her gerissen und mit kräftig baritonalen Klang: Simon Bailey) vertreibt sich beim Golf spielen die Zeit und Poppea (intensiv berührend: Anna Ryberg) tanzt in der eleganten Bar mit ihrem ganz in weiß, auf unschuldig gekleideten, wackeren Ottone (den der amerikanische Countertenor Lawrence Zazzo gibt) um den Cembalisten Stefano Maria Demicheli herum.
Juanita Lascarro´s Agrippina ist eine kühl berechnende Frau, die ihre Reize sehr wohl einzusetzen weiß und so weniger eine diabolische als äußerst attraktive Dame gibt (quasi ein Wolf im Schafspelz). Ihr ergeben ist Pallante (mit klarem Baß: Soon-Won Kang), als weitere Männer im Staate Rom: Narciso (Countertenor: Christopher Robson) und Lesbo (Gérard Lavalle).
Die spätere Exaltiertheit Neros macht imponierend Malena Ernmann deutlich. Im lockeren, weiten Freizeitdress (auch der wirkliche Nero soll eher lockere Freizeitkleidung bevorzugt haben) gibt sie den Nerone äußerst jugendlich, mit wilden blond gefärbten Haaren robbt sie selbst verliebt über die Bühne und singt dabei noch vortrefflich.
Für den erkrankten Paolo Carigani leitete Felice Venanzoni die Barockspezialisten des Frankfurter Museumsorchesters. Ein nahezu komödiantisches Spiel um Macht und Liebe, nicht ohne Grund auch in der nächsten Spielzeit wieder im Programm der Oper Frankfurt.
Markus Gründig, Juni 06
La finta semplice
Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot
Besuchte Vorstellung: 24. Juni 06
Manche Theater verlegen im Sommer ihre Bühne nach draußen. Die Oper Frankfurt holt sich bei der letzten Neuproduktion der aktuellen Spielzeit den Sommer in die Spielstätte des Bockenheimer Depot.
Eine sommerliche, beschwingte Atmosphäre herrscht dort bei Mozarts Frühwerk „La finta semplice“ (Die Einfältige aus Klugheit). Der Boden besteht aus Holzplatten, im Hintergrund strahlt ein mächtiger hellblauer Wolkenhimmel. Ein dem Grundriss des Bockenheimer Depots nachempfundenes großes Holzgerüst beherrscht die Szenerie, es ist nach allen Seiten offen. Strohballen an der Seite unterstreichen den ländlichen Bezug, während ein Haufen zusammengestellter Möbel, Matratzen und Koffer für Ankunft und Abreise stehen. Seitlich neben der Bühne sind jeweils zwei große Schminktische nebst Spiegeln platziert, die von den Darsteller zum ausruhen und umziehen genutzt werden (Bühnenbild und Kostüme: Herbert Murauer).
Offenheit hat Regisseur Christof Loy bei dieser Inszenierung in verschiedenen Ebenen angewandt. Schon vor Beginn befinden sich einzelne Sänger auf der Bühne, andere kommen während der Ouvertüre aus der Seitentür dazu. Zunächst in Alltagskleidung, als seien sie Passanten die mal schauen wollen, was denn hier los ist. Dieser „Bewegungsreichtum“ zieht sich durch die Aufführung, so dass es während der drei Stunden Aufführungsdauer zu keinerlei Stillstand auf der Bühne kommt und der Spannungsbogen stets gespannt bleibt (was bei diesem aus überwiegend aus Rezitativen und Arien bestehenden Werk ein Spitzenleistung für sich ist).
Dazu wird auch mal zwischendurch in Deutsch oder Englisch geflucht, ein Handyklingeln entpuppt sich als zum Stück dazugehörend und Hausherr Don Cassandro legt sich nur mit Shorts bekleidet zum Sonnenbad nieder. Loy nutzt allerhand Einfälle, die wie selbstverständlich erscheinen und den humoristischen Grundgedanken des Stücks treffend akzentuieren.
Für diese wundervoll stimmige Inszenierung sind natürlich nicht zuletzt die jungen Sänger verantwortlich, die hier mit tadellosem Gesang überzeugten und mit großem darstellerischem Ausdruck spielten. Alle geben hier ihr Rollendebüt. Bei der besuchten Vorstellung sangen Alexandra Lubchansky (als mondäne Drahtzieherin Rosina) und Christian Dietz (als stimmstarker Fracasso) trotz Erkältungsproblemen. Robin Adams gab dem Don Cassandro ein markantes Profil und Britta Stallmeister ging sichtbar in der Rolle der Ninetta auf.
Sein Rollendebüt und sein Debüt an der Oper Frankfurt hat hier der Amerikaner Nicholas Phan, der dem Don Polidoro mit viel Einfühlungsvermögen und seinem strahlenden Tenorklang großes Format gab, die Überraschung des Abends. In weiteren Rollen zudem Jenny Carlstedt (Giacinta) und Florian Plock (Simone).
Mozarts Farbenreichtum brachte das Frankfurter Museumsorchester unter der Leitung von Julia Jones zum Blühen, tatkräftig unterstützt von der Continuo Gruppe Francesca Zamponi (Cembalo) und Johannes Oesterlee (Violoncello).
Bei diesem lustigen Drama mit Musik (dramma giocoso per musica) geht es nicht wie sonst in der Oper um Leiden, Krankheit und Tod, sondern um ein heiter, beschwingtes Spiel über die Lust (und Unlust) an der Ehe, das man nicht versäumen sollte, sich zum Ausklang eines schönen Sommertages anzuschauen. Die letzten drei Termine sind: 28. & 30. Juni sowie am 2. Juli 06.
Markus Gründig, Juni 06
Die verkaufte Braut
Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 1. Juni 06
Nach der Schwere des Parsifal folgte an der Oper Frankfurt nun zum Ausgleich ein heiteres Musiktheaterwerk, Smetanas Oper „Die verkaufte Braut“. Keine mystische Geschichte, sondern das pralle Leben einer Dorfgemeinschaft mit einem Heiratsvermittler, der sich um das Glück der Gemeinschaft sorgt. Smetana, vor allem bekannt durch „Die Moldau“, bezeichnete das Stück als Operette, in der Inszenierung von Stein Winge kommt es mit einigen wenigen gesprochenen Textstellen als ernstes wie heiteres Musiktheaterwerk auf die Bühne. Obwohl „Die verkaufte Braut“ als die tschechische Nationaloper schlechthin gilt, wird in der Frankfurter Inszenierung nicht wie sonst üblich in der Originalsprache, sondern in deutscher Sprache gesungen. Auf Übertitel wurde verzichtet, so ist ein ganz besonders konzentrierteres Zuhören nötig, um die gesungenen Wörter auch zu verstehen.
Die Bühne wurde von Benoît Dugardyn in ein helles Weiss getauft und mit viel Licht ausgeleuchtet. Weißer Boden, auf dem kreisförmig aneinandergereiht und sich in die Mitte zulaufend (wie ein Schneckenhaus) die Umrisse von Fachwerkhäusern als Ausdruck des dörflichen Lebens stehen. Der Blick nach Innen ist frei, eine Privatsphäre gibt es auf dem Land nicht. Mit dem Einzug der Dorfbevölkerung aus dem Schlund der Bühnenmitte wird die Häuserfassade zusätzlich mit zahlreichen Blumenkästen (roten Geranien) frühsommerlich eingekleidet. Für die Wirtshausszene im zweiten Akt werden traditionelle Bierzeltgarnituren vor diese Häuserzeilenkulissen auf die Bühne gebracht, auch diese sind wieder in Blau und Weiß eingetaucht. Weiß-Blau dominiert auch bei den Kostümen, wo die Männer Handwerker und die Frauen Putzfrauen darstellen (mit vitaler Energie der von Alessandro Zuppardo einstudierte Chor der Oper Frankfurt).
Die Bühnenwände sind mit kachelähnlichen weiß-blauen folkloristischen Motiven versehen, ebenso die Wand zur Bühne, die als Vorhang dient und vor der während der Ouvertüre eine Putzfrau fleißig das Reinigungstuch zum Einsatz bringt (von oben grüßen Handwerker). Doch statt eine Kachel zu putzen, verschmiert das Motiv, die heile Dorfwelt hat einen kleinen Kratzer bekommen. Am Ende wird der Heiratsvermittler an gleicher Stelle stehen.
Mit lauten Getöse erfolgt der Einzug des Zirkus im dritten Akt, bei dem die Häuserzeile zusammengestaucht in der Ecke steht: ein alter VW-Bus durchbricht die Kachelwand und entlädt die Komödiantentruppe (u.a. mit Stelzenläufer und Feuerjongleur), die in prächtig schillernden Kostümen (Jorge Jara) den Dorfplatz in Beschlag nehmen.
Insgesamt schöne Optiken, die folkloristische Elemente einfangen, ohne ins Sentimentale zu verfallen und dennoch groß wirken.
Herausragende Figuren sind vor allem Marie, Hans, Wenzel und der Heiratsvermittler Kecal. Die Marie wurde von der jungen Maria Fontosh sehr einfühlsam mit kräftigem Sopran gesungen. Der erfahrene Gregory Frank (mit leichter Elvis-Tolle) glänzte nicht nur mit seinem starken Bass, sondern bot auch darstellerisch einen fulminant schillernden Geschäftsmann.
Tenor Jonas Kaufmann, sonst in der Rolle des Hans, musste krankheitsbedingt diese Vorstellung kurzfristig absagen. Pressereferent Holger Engelhardt wies das Publikum vor der Vorstellung darauf hin, dass aufgrund der Kürze der Zeit kein vollwertiger „Ersatz-Hans“ zur Verfügung stehe. Carsten Süß, der den Wenzel singt, werde auch die Rolle des Hans singen, die von der Regieassistentin Katharina Thoma gespielt werde, der Abend sei so quasi eine Uraufführung. Eine Lösung die sicher nicht alltäglich ist, aber funktionierte: Süß gab nicht nur klangschön einen herrlich, leicht einfältigen und stotternden, liebenswerten Außenseiter Wenzel, sondern auch sängerisch einen respektablen Hans (am seitlichen Pult). Besonders stark: sein Duett als Wenzel mit Marie. Katharina Thoma als spielender Hans zeigte keinerlei Verlegenheit und fügte sich bestens ein.
Roland Böer leitete das Frankfurter Museumsorchester und brachte die vielfältigen Raffinessen Smentanas dicht wie warm zum Erklingen.
Markus Gründig, Juni 06
Unsichtbar Land
Theater Basel
Besuchte Vorstellung: 7. Mai 06 (Premiere / Uraufführung)
Das Alte bewahren, sich aber auch dem Neuen öffnen ist in vielen Bereichen des Lebens wichtig. Im Bereich der Oper wird heutzutage Werken vergangener Zeiten mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als modernen Werken. Den Spagat beide musikalische Welten miteinander zu verbinden, ja zu verweben, hat Helmut Oehring (Jahrgang 1961) mit seiner Oper „Unsichtbar Land“ geschafft, die als Auftragswerk des Theater Basel nach einer Idee von Claus Guth und Christian Schmidt jetzt daselbst uraufgeführt wurde.
Oehring verbindet hier Musik von Henry Purcell (u.a. Auszüge aus dessen Vertonung von Shakespeares „Der Sturm“) mit seiner eigenen modernen, allerdings nicht dominierenden Komposition mit Klangcollagen-Charakter.
Dazu sind in „Unsichtbar Land“ zwei Handlungsebenen miteinander verbunden: die Geschichte Herzog Prospero´s und seiner Tochter Mirinda mit dem Bericht des Polarforschers Ernest Shackleton über eine gescheiterte Expedition in die Eislandschaft (die Auswahl und Montage der Texte erfolgte durch Kai Grehn).
Die Oper mit dem Untertitel “Oper in 7 Tagen“ ist dem Bericht folgend, auf sieben Tage aufgeteilt, in Basel bildete Sie zugleich den Abschluss der Intendanz von Michael Schindhelm. Sie spannt einen großen musikalischen Bogen von den Anfängen der Oper bis in die heutige Zeit. Groß ist nicht nur die Spannbreite zwischen den Stilen (Barock-Moderne), sondern auch der Aufwand, der vom Theater Basel für diese Produktion betrieben wurde.
Neben Gesangssolisten (Rita Ahonen, Karl-Heinz Brandt, Arno Raunig, Catherine Swansson und Bjørn Waa), Schauspielern, dem Chor des Theater Basel (und dem Sinfonieorchester Basel (musikalische Leitung Jürg Henneberger) spielte das Barockensemble der Schola Cantorum Basiliensis (Cembalo und Leitung: Giorgio Parunuzzi), das hervorgehoben in der Mitte der ersten Zuschauerreihen platziert wurde. Dazu drei auf die Seiten verteilte Solomusiker (Bassklarinette/Kontrabassklarinette, Trompete und E-Gitarre), ein Counter-Sänger (Sopranist Arno Raunig, u.a. mit dem bekannten „Cold-Song“: „What Power are Thou“), ein Tänzer (Fabio Pink) und drei Gebärdensolisten (Christina Schönfeld, Ralf Engelmann, Jan Sel; Helmut), die voll in die Handlung integriert wurden und deren Gebärden weitgehend zusätzlich auf einer Textlaufschrift zu lesen sind.
Zweigeteilt ist da natürlich auch die Bühne, die Christian Schmidt für diese Aufführung geschaffen hat. Für die alte Welt stellvertretend: Prosperos Heim ist eine traditionelle Bibliothek auf drei Ebenen, gewölbt und wohl durchaus gewollt, durch die Verbindungsleitern an ein Schiff erinnernd, dazu Lesetische an den Bühnenseiten. Hinter der Bibliothek verbirgt sich die Eislandschaft, als weiter, kühler Raum und mit unterschiedlich angeordneten schwarzen Miniaturfiguren.
Durch den regen Einsatz der Drehbühne wechseln diese beiden Bilder ständig, wobei sich auf beiden Welten ständig neue Positionen ergeben. Sind Handlung und Musik anfangs noch getrennt, verbinden sie sich im Laufe der Woche immer mehr. Die Inselbewohner auf der alten Welt machen sich auf in die Eislandschaft, Chaos und Untergang herrscht schließlich in der Bibliothek. Dabei wird nicht nur gesungen, es gibt auch viele Sprechpassagen der beiden Schauspieler Urs Bihler und Helene Grass, ganz der Tradition der Semi-Opern folgend (über die der zeitgenössische Dramaturg Peter Motteux gesagt hat „Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass unser englisches Gemüt nicht diesen fortwährenden Gesang verträgt…“). Regisseur Claus Guth wechselt einfühlsam zwischen den großen Volksszenen und intimen Einzelschicksalen, lässt die Darsteller auch mal aus ihrer Welt ausbrechen und an den Bühnenrand oder Bühnenseite kommen. Er hat sich viele Aktionen einfallen lassen und schafft bei dieser pausenlos zweistündigen Aufführung ständig neue Bilder, bei aller Begrenztheit.
Ohne ins Bewusstsein gerückte Vergangenheit keine Zukunft ? „Unsichtbar Land“ macht deutlich, wie bemerkenswert harmonisch hier diese Verbindung möglich ist, optisch und musikalisch. Dazu der gestikreiche Einsatz der Gebärdensolisten, dessen Sprache zum Ende hin vom Chor bewegend übernommen wird. Ein mehr wie geglücktes Projekt.
Markus Gründig, Mai 06
Parsifal
Oper Frankfurt
Besuchte Vorstellung: 30. April 06
Die Suche nach dem heiligen Gral, Ritter und Mythen bilden eine gute Idee für eine Oper. Bereits im Beginn des 13. Jahrhunderts hat der Dichter Wolfram von Eschenbach sein Epos „Parzival“ vollendet, das vom Artusritter Gawan und von der Entwicklung Parzivals vom naiven Unwissenden zum Gralskönig handelt, von des Menschen Suche nach Befreiung und Erlösung . Doch erst Jahrhunderte später wurde das Epos musiktheatralisch bearbeitet. Richard Wagner diente dieser Versroman als Ausgangsstoff für sein letztes Werk, das Bühnenweihfestspiel „Parsifal“, für das er nicht nur die Musik komponierte, sondern auch das Textbuch schrieb.
Von dem dort vorgegebenen Wald, der Gralsburg und des Zauberschlosses ist in der Inszenierung von Christof Nel nichts und doch alles zu sehen. Jens Kilians Bühne zeigt einen überdimensionalen schwarzen Lattenzaun, der die beiden Drehbühnen umschließt (was bei einer Bühnenbreite von nahezu 40 Metern eine Menge Holz ist).
Dieser Zaun ist alle Aufzüge hindurch präsent, wird zeitweise geöffnet um neue Räume zu eröffnen, wie etwa den Speisesaal wo Amfortas und Titurel aufeinander treffen oder das Sterbezimmer Titurels.
Der Zaun wirkt wie ein gewaltiger, massiver Schutzzaun, der die dahinter vermutete Gralsburg umso mystischer erahnen lässt. Geöffnet wirkt selbst bei der kleinen Drehbühne der Raum wie eine große Halle, ein paar schwarze Ritter in den Seiten und das behutsame wie effektvolle Licht (Olaf Winter) sorgen für vielfältige starke Eindrücke. Die Bühne ist nahezu ständig in Bewegung, wenn auch oft sehr langsam. So kommt bei aller Ruhe und der ja die nicht geraden kurzen Aufführungsdauer (ca. 5 ½ Stunden) hindurch nie ein Moment der Langeweile auf. Loy´s sicheres Gespür für bühnewirksame Effekte und stilsichere, ruhige Personenführung wirken den Abend hindurch. Großartig angelegt ist auch die Versuchung der Mädchen im zweiten Aufzug. Erst tänzeln die Mädchen im grau-braunen Mäntelchen um Parsifal herum, entledigen sich dann ihrer Mäntel und versuchen ihn sodann im leuchtenden liebesroten Kleid für sich zu gewinnen. Ein optisch wie inhaltlich überzeugendes Bild.
Solistisch wie darstellerisch ragt die Mezzo-Sopranistin Michaela Schuster am meisten heraus. In Frankfurt im letzten Jahr bei der konzertanten Aufführung von Verdis „La Forza del Destino“ zu erleben, sang sie in 2005 die Kundry bereits in der Berliner Inszenierung von Bernd Eichinger. Das Geheimnisvolle, wie auch ihren Wahn, zeigt sie facettenreich mit immenser Intensität. Den todessehnsüchtiger Amfortas gibt ebenso intensiv und überzeugend Alexander Marco-Buhrmeister. Mit wohl tönendem kräftigem Bass gibt Jan-Hendrik Rootering einen wunderbaren Ritter Gurnemanz. Als König Klingsor dunkel finster und gerade deshalb anziehend: Paul Gay.
Der Australier Stuart Skelton verleiht im weißen Anzug dem reinen Parsifal eine trefflich tumbe Erscheinung, von der er sich im Schluss dann wunderbar befreien kann.
In weiteren Rollen u.a. Magnus Baldvinsson als Titurel sowie Hans-Jürgen Lazar und Gérard Lavalle als Gralsritter.
Insgesamt wird sehr textverständlich gesungen (wobei der Text zusätzlich im Übertitel angezeigt wird) und auch die Chöre zeigen sich in gewohnt starker Klasse. Ausgewogen das Dirigat von Paolo Carignani, stark in den vielen zarten Streicherklängen und mit blech-dröhnende Wucht etwa bei der Ankunft in der Gralsburg im dritten Aufzug.
Eine Inszenierung die die Menschen in den Mittelpunkt stellt, ihr Leiden und ihr Lieben. Sie wirkt modern und zeitlos gleichermaßen und kann so zum Maßstab für künftige Parsifal-Inszenierungen werden.
Tosender Applaus in der ausverkauften Oper Frankfurt.
Markus Gründig, Mai 06
Turandot
Opernhaus Zürich
Besuchte Vorstellung: 9. April 06 (Premiere)
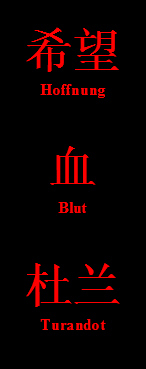
Ein Märchen chinesischen Ursprungs, mit Tragik, eine zynische Geschichte und fremdländischen Elementen und dann auch noch der Opernschlager „Nessun Dorma!“ („Kein Schlafen“), die Perle unter den Tenorarien. Turandot ist voll von Pathos und großen Gefühlen. Und dennoch, kaum dass sich der Vorhang geöffnet hat, nimmt einen die Musik Puccinis gefangen, wird im Gehirn ein Schalter umgelegt und die bewegende, romantische Musik durchströmt den ganzen Körper, packt einen und irgendwann werden sogar die Augen vor Ergriffenheit feucht. Kein Wunder, dass Turandot gerne für Großproduktionen genutzt wird und die „Nessun Dorma!“ Arie in der Werbung ein Sinnbild für italienische Romantik ist.
Am Opernhaus Zürich wurde Turandot zuletzt in der Spielzeit 1987/88 gespielt, es war also längst Zeit für eine Neuinszenierung. Regisseur Gianarlo del Monaco gewinnt für die Produktion am Opernhaus Zürich diesem Publikumsfavoriten neue Facetten ab, erzählt sie nachvollziehbar ohne sie mit waghalsigen Regieeinfällen auf den Kopf zu stellen. Der Tatarenkönigsohn Calaf wird als Außerirdischer, als Fremdkörper in zeitlicher Sicht (und weniger geografischer) in die Welt der Chinesen gestellt (schließlich sieht sich die kühle Turandot ja auch nicht als von dieser Welt an). Der Vorhang öffnet sich und noch bevor die ersten kraftvollen Takte erklingen, leuchtet ein grüner Laserstrahl einen Lichtkegel auf die Bühnenmitte und beamt Calaf hinein. Er landet auf diesem Erdenfleck fast so wie im Film der Terminator, hier allerdings nicht nackt sondern in aktueller Alltagskleidung, mit Lederjacke, dunkelgrauen Pulli, schwarzer Hose und Sonnenbrille, ganz so als wolle er nur zu einer Probe gehen oder Georg Michael imitieren.
Der Laserstrahl bricht ab und mit den gewaltigen dreifachen Fortissimo des Eingangsmotiv wird der Blick auf den Palast des Kaisers frei: ein Jade-Stein grünlich marmorierter, mit glatten Steinquadern versehener Machtstrotzender Palast, erhaben, bedrohlich und düster. Peter Sykora´s Bühne gleicht einem mystischen, monumentalen Tempel, der zum Bühnenrand hin trichterförmig mit Stufen versehen, abfällt. Aus diesem schwarzen Loch entsteigt immer wieder der Chor, das gesichtlose Volk, stets im Halbdunkel verweilend, mit fahlen, erdbraunen und grauen lodrigen Kostümen gekleidet. Die Schreie, Protestrufe und Wutausbrüche des Volkes übertönen den vollen Orchesterklang, Jürg Hämmerli führt den Chor zu imposanter, weit strahlender Stärke bei stets klarem Klang. Alan Gilbert am Pult treibt das Orchester zu Höchstleistungen und lässt die raffinierten Instrumentationen genau hörbar werden.
Der Kaiser steht stets hoch oben über allem, unter ihm eine Tür, die sich einem Aufzug gleich, seitlich öffnet und aus der die Wachen, die Diener und auch die Prinzessin treten. Die Kostüme verbinden klassische chinesische Motive mit abstrakten Elementen, wie metallernde Skulpturen auf den Köpfen, die bei zwei Wachen gar wie Antennen aussehen. Bezaubernd schlicht und dabei mit großer Signalwirkung.
Die drei harlekinartigen Würdenträger des kaiserlichen Hofes Ping, Pang und Pong hat Puccini von Gozzis Vorlage übernommen und ihnen, insbesondere zu Beginn des zweiten Aktes, einen (zu)großen Anteil zugewiesen. Eine Wand, von einer große Bibliothek umrahmt, ist ihr Raum (ansonsten besteht der Palast als Einheitsbühnenbild), doch stehen hier statt Bücher die Masken der vielen ermordeten Prinzen, die es nicht geschafft hatten, Turandots drei Rätsel zu lösen. Das dies Calaf gelingt, verdankt er einem Laptop, den er gleich unter seiner Jacke mit sich trägt. Lässig raucht er eine Zigarette, bevor er der Prinzessin entgegentritt.
Den Transformationsbogen schließt Monaco mit dem Ende nach Alfanos. Calaf hat Turandot mit seinem Kuss befreit und gewonnen, sie verkündet seinen Name (Liebe) und die Mauern des kaiserlichen Palastes verschwinden, als würde sich der Himmel öffnen geht ein großes „Aaahhh“ durch den Saal und der Blick ist frei auf die schillernde Nachtskyline von Shanghai (wo diese Inszenierung im Sommer als Koproduktion zu sehen sein wird). Der Chor entsteigt jetzt mit aktueller Businesskleidung seiner Gruft, Turandot legt ihren prachtvollen Mantel ab und macht im roten Abendkleid eine gute Figur. Sie schreitet zum elegant gedeckten Tisch und feiert zusammen mit Calaf, Champagner trinkend, ihr neues Glück. Herz was willst du mehr?!
Der hohe ästhetische Eindruck wird von der hervorragenden Leistung der Sänger erstklassig unterstützt. Star des Abends ist zweifellos der argentinische Sänger José Cura. Die „Nessun Dorma!“ Arie singt er während er träumend auf dem Rücken liegt und zu den Sternen hoch schaut. Seinem Charisma und der Strahlkraft seines Tenorklangs tut diese ungewöhnliche Singposition dabei keinerlei Abbruch, er hat die Rolle sicher im Griff.
Distanzierte Kälte vermittelt Paoletta Marrocu bei ihrem Rollendebüt als Turandot, auch wenn sie meist weit hinten im Palast steht und die Distanz zum Publikum dadurch größer wird. Auch die weiteren Sänger hatten hier ihr Rollendebüt (Cura als einziger nicht). Elena Mosuc sorgte als aufrecht liebende Liu mit zarter Tongebung für bewegende Anteilnahme (und stürzte sich von den Mauern anstelle in einen Dolch). Pavel Daniluk gefiel als Timur. Unter Ihren Masken nicht immer auszumachen die drei Minister Ping, Pang und Pong (Gabriel Bermudez, Andreas Winkler und Boguslaw Bidzinski), stimmlich schön waren sie dennoch alle drei.
Keine Aufführung zum großen Disput, aber eine für einen wunderbaren Bilderbuchopernabend.
Markus Gründig, April 06
Der Rosenkavalier
Komische Oper Berlin
Besuchte Vorstellung: 2. April 06 (Premiere)
Nach seinen die Grenzen der Tonalität sprengenden Opern „Salome“ und „Elektra“ schrieb Richard Strauss zusammen mit dem Textdichter Hugo von Hofmannsthal die Oper „Der Rosenkavalier“. Scheinbar rückwärtsgewandt weist diese Oper weniger Dissonanzen auf, dafür immer wieder stimmungsvolle Walzerglückseligkeit. Unbeschwert und humoristisch einerseits, ausdrucksstark und mit vielen Finessen andrerseits. Die Geschichte des Herrn Baron Ochs auf Lerchenau ist eine Klamotte ersten Ranges, dazu eine Liebesgeschichte mit Verwicklungen und zu guter letzt einem Happy End mit resignativen Zügen-.
Ursprünglich sollte das Team Paul Steinberg/ Richard Jones diese Oper an der Komischen Oper Berlin inszenieren, die beiden schieden aber wegen Unstimmigkeiten hinsichtlich des geplanten Ausstattungskonzepts bereits im Dezember 05 aus. Intendant Andreas Homoki erklärte die Angelegenheit zur Chefsache und zur Premiere kam eine Weiterentwicklung seiner Inszenierung aus dem Frühjahr 99 am Theater Basel.
Frank Philipp Schlößmann´s Einheitsbühnenbild des kahlen weißen Salons wurde noch ein wenig mehr verkleinert um den kammerspielartigen Charakter deutlicher hervorzustellen. Trotz der Konstante des Raums weht der Wind der Zeit durch diesen Salon, der Schlafzimmer, Saal bei Herrn von Faninal und spukendes Gasthauszimmer in einem ist: von ein wenig Rokoko über mit schwarzen Möbeln angedeuteten Jugendstil bis hin zur auf den Kopf gestellten Neuzeit. Die Zeit fließt durch uns und nicht an uns vorbei, will Homoki damit sagen. Zusammen mit seinem Co-Regisseur Werner Sauer führt er die komplett gut viereinhalb Stunden Aufführungsdauer hindurch die Figuren stets nah an der Musik und bindet auch den Chor aktiv mit ein.
Anfangs beruhigen sich die Feldmarschallin und Octavian nach ihrem Liebesspiel nicht im, sondern neben dem Bett auf dem Boden, was dem ganzen einen erfrischenden Rahmen gibt. Bei der Überreichung der silbernen Rose (die stets in einer kleinen Schachtel bleibt) gefriert die versammelte Dienerschaft zu einem Standbild, die Ergriffenheit des sich neu gefundenen Paares transportiert sich dadurch gut in den Zuschauerraum. Homoki verzichtet auf eine medienwirksame Neuinterpretation und setzt dezent Akzente.
Der dem Stück innewohnende Epochenwechsel wird zudem durch Gideon Davey´s Kostüme unterstrichen, die für diese Inszenierung neu entworfen wurden und sich von Aufzug zu Aufzug der Zeit anpassen, bis hin zum lila gelben Baseball-Shirt eines Jungen kurz vorm Schluss.
Kirill Petrenko und das Orchester der Komischen Oper schaffen es meisterhaft, die Straußschen Feinheiten deutlich herauszuarbeiten, sie unterstreichen die Derbheiten des Textes wie auch den inne liegenden leisen Wehmut. Die herzerwärmenden Walzertöne werden forciert gespielt, umso ruhiger und klarer die leisen Töne wie beim Zwitschern der Vögel oder das angedeutete Schlagen der Uhren. Mit viel Verve gehen sie die gewaltigen Creshendo´s an, bei denen es mitunter auch ordentlich Donnert und Blitz. Musikalisch ein Höhepunkt.
Sängerisch gefallen die Mitglieder der Komischen Oper Berlin, allen voran die drei Hauptrollen Feldmarschallin (Geraldine McGreevy), Oktavian (Stella Doufexis) und Baron Ochs (Jens Larsen). McGreevy gibt die Feldmarschallin als gestandene, charismatische Grand Madame, die starke Lust am Leben hat und dennoch von der Begrenztheit der Liebe weiß. Am Ende steht sie alleine da (das Paar Oktavian/Sophie singt hinter der Bühne), entsteigt ihrem Kostüm. Nicht traurig, nicht erfreut, sondern gefasst und bereit das zu akzeptieren, was nicht zu ändern ist.
Doufexis ist ein flammender Oktavian und Larsen, in seinen ein wendig verlottert wirkenden Anzug wirkt als grotesker Landadeliger Ochs als vitaler und doch irgendwie liebenswerter Lüstling, ein glänzendes Beispiel darstellerischer Präsenz.
Obwohl in Deutsch gesungen wird, ist vom Text nicht immer viel zu verstehen. Da auch auf Übertitel verzichtet wird, ist dies schon bedauerlich, denn gerade bei dieser Oper hat der Text, von der Musik korrespondierend unterstrichen, seine Bedeutung.
Dennoch, ein sehens- und hörenswerter Rosenkavalier.
Markus Gründig, April 06



